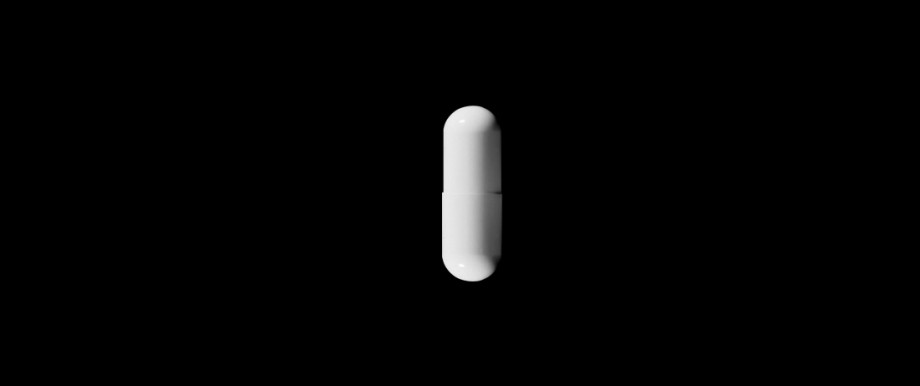Schorsch sitzt neben dem Kassettenrekorder und ist ganz versunken in die Musik. Hin und wieder huscht ein Lächeln über sein Gesicht. Stundenlang hört er "Ernst Mosch und die Original Egerländer Musikanten". An diesen Moment kann sich der heute 66-jährige Gebhard Stein noch gut erinnern, auch nach fast 50 Jahren. Er lernt Schorsch im Januar 1972 bei seinem Ersatzdienst in den "Korker Anstalten" kennen.
Viele Jahre hatte Stein nicht mehr an seine Zeit als Zivi und die Begegnung mit Schorsch gedacht. Bis er Anfang 2015 im Radio einen Beitrag zu Medikamententests an Schweizer Heimkindern hört. In der Psychiatrischen Klinik Münsterlingen im Schweizer Kanton Thurgau wurden von 1950 bis Mitte der Siebzigerjahre an mindestens 1600 ahnungslosen Patienten Psychopharmaka getestet - auch an Heimkindern.
Plötzlich wird Gebhard Stein klar, dass so etwas auch im südbadischen Kork passiert sein könnte. Kurzerhand entschließt er sich, den Autor des Radiofeatures zu treffen und ihm die Geschichte von Schorsch zu erzählen. Das Gespräch setzt eine über dreijährigen Recherche in Gang, sie wird zu einem Tauchgang in die dunklen Kapitel der Medikamentenforschung in der Nachkriegszeit.
Die Ärzte dort diagnostizierten bei ihm einen "frühkindlichen Hirnschaden"
Der erst 20 Jahre alte Zivildienstleistende Gebhard Stein wird in Kork in der Abteilung "Männer 2" im Nachtdienst eingeteilt, bei dem er allein für etwa 80 Heimbewohner zuständig ist. Zu seinen Aufgaben gehört es auch, die Medikamente für den nächsten Tag zusammenzustellen. Dabei fällt ihm eine Arznei auf, die mit Buchstaben und Ziffern beschriftet ist, wobei er sich nach all den Jahren nicht mehr an die genaue Zeichenfolge erinnern kann, irgendetwas mit SH-08 ... Stein hakt damals bei den Assistenzärzten nach. Deren Antwort: Das sei eine Versuchspille gegen den Trieb. An mindestens drei Jugendlichen hat er die Substanz täglich verteilen müssen, erinnert sich Stein.
Einer dieser Jugendlichen ist Schorsch. Als Gebhard Stein ihm zum ersten Mal begegnet, ist er 14 Jahre alt, ein kräftiger Junge, aber mit auffallend großen Brüsten und einem breiten Becken. Der mittlerweile promovierte Sozialwissenschaftler Stein vermutet deshalb, dass der 14-Jährige das Versuchsmedikament schon längere Zeit vor seinem Dienstantritt im Januar 1972 bekommen hatte.
Schorsch hatte sein Heimatort auf der Schwäbischen Alb schon im Alter von elf Jahren verlassen. Der Hausarzt hatte empfohlen, ihn in den "Korker Anstalten" unterzubringen, einer evangelischen Behinderteneinrichtung in der Nähe von Straßburg. Schorsch lebt hier bis 1976 in der Abteilung "Männer 2". Die Ärzte dort diagnostizierten bei ihm einen "frühkindlichen Hirnschaden". Er bekommt häufig Krampfanfälle, leidet an einer "Epilepsie mit Grand-mal".
Seit 2010 ist Frank Stefan Vorstandsvorsitzender der "Diakonie Kork" mit heute etwa 1400 Beschäftigten. Der Pfarrer kann sich nicht vorstellen, dass hier Anfang der Siebzigerjahre Ärzte ein triebhemmendes Medikament an wehrlosen Menschen testeten. Aber aufklären könne man es auch nicht mehr, behauptet er, weil "es keine Akten mehr aus dieser Zeit gibt und die damals zuständigen Ärzte auch nicht mehr leben".
Der Wunsch nach Sex wurde tabuisiert
Frank Stefans Amtsvorgänger, der Theologe und Psychologie-Professor Joachim Walter, hält den Medikamentenversuch in Kork hingegen durchaus für möglich: "Ich weiß, dass die Schwestern triebhemmende Medikationen vor allem denjenigen gegeben haben, die einen größeren sexuellen Wunsch hatten." Als er 2002 seinen Dienst in Kork begann, sei das sexuelle Selbstbestimmungsrecht der Menschen mit Behinderungen noch in weiter Ferne gewesen. Der Wunsch nach Sex störte in diesen Einrichtungen und wurde tabuisiert. Auch in der Vorstellung vieler Eltern waren behinderte Jugendliche wie Kinder, die sicher keine sexuellen Fantasien hätten - ein großer Irrtum.
Der Arzt Volker Blankenburg bestätigt den Einsatz zugelassener triebhemmender Medikamente in Kork: "Da gab es zugelassene Psychopharmaka, hauptsächlich Neurocil und Haldol, die man da mal eben verabreicht hat." Man habe die Menschen damals vor sich selbst und auch die Mitbewohnerinnen schützen wollen. 1967 begann Blankenburg als "Medizinalassistent" in Kork, später leitete er die Epilepsieklinik für Erwachsene. Es liegen schriftliche Informationen aus dem Umfeld von Kork vor, die belegen: Volker Blankenburg war im Jahr 1976 an der Überweisung von Schorsch in die Psychiatrie beteiligt.
Detailreich erinnert er sich an den Klinikalltag. Schon frühmorgens, erzählt der Arzt, habe er an seinem Bürofenster fürchterliche Schreie gehört. "Einmal kam mir ein Betreuer entgegen, blutend, ihm wurde ein Stück Muskel von einem Heimbewohner rausgebissen. Manchmal musste ich die Patienten dann ans Bett fixieren und medikamentös beruhigen." Wenn es aber um die Versuchssubstanz geht, sagt Blankenburg: "Ich kenne dieses Medikament nicht."
Auf der Suche nach der Herkunft des Medikaments entsteht die Vermutung, dass das Kürzel SH für das Berliner Pharmaunternehmen Schering stehen könnte, das seit 2006 zur Bayer AG gehört. Die teilt auf Nachfrage allerdings mit, dass sich "nach umfangreicher interner Recherche in den Archiven der Schering AG ergeben hat, dass es nach derzeitigem Wissensstand keine Substanz oder Formulierung einer Substanz mit der Nummer SH-08714 gibt."
Doch stimmt das? Im internen Schriftverkehr unter Bayer-Mitarbeitern, der der SZ vorliegt, heißt es: "Ich habe die SH-Nr. von Cyproteronacetat gefunden." Am Ende entscheidet sich Bayer dennoch, die Information zurückzuhalten und schreibt an die beteiligten Mitarbeiter: "Die angefragte Substanz gibt es nicht und wir sollten die Antwort an den Journalisten zum jetzigen Zeitpunkt darauf beschränken."
"Ein unglaublicher Akt der Gewalt"
Währenddessen geht die Recherche voran. Gebhard Stein sieht seinen Verdacht bestätigt. In seine Erinnerung hatte sich lediglich ein Zahlendreher eingeschlichen, alles andere passt: Die gesuchte Substanz heißt SH 8.0714, es handelt sich um Cyproteronacetat. Sie wurde unter dem Namen "Androcur" 1973 von Schering in den Markt eingeführt.
Rückblick, New York, 1966. Ein Vorstandsmitglied von Schering landet in der US-Metropole. Im Gepäck die Hoffnung auf ein lukratives neues Medikament. Er sucht nach einem Mediziner, der die Substanz in den USA klinisch testen kann. Im "Mount Sinai Hospital" wird er fündig: Ein deutscher Arzt, der damals 35-jährige Martin Friedrichs, übernimmt die Betreuung der Studie.
"Cyproteronacetat" soll Prostatakrebs heilen helfen, aber die klinische Prüfung verläuft nicht wirklich erfolgreich. "Wir hatten ungefähr 360 Patienten, alle vorbehandelt und dann umgestellt auf Cyproteronacetat. Wir konnten sagen, der Tumor ist nicht weitergewachsen, aber das wäre vielleicht auch so nicht passiert", sagt Martin Friedrichs heute. Schering habe daraufhin auf eine Zulassung in den USA verzichtet. Für den Pharmakonzern sei das eine Katastrophe gewesen, er hatte viel Geld in die Entwicklung der Substanz gesteckt.
Arzneimittelhersteller raten zur Vorsicht
Doch eine Hoffnung blieb: Schering wusste bereits Anfang der Sechzigerjahre nach Tierversuchen, dass Cyproteronacetat die Wirkung der männlichen Sexualhormone unterdrückt. Diesen Effekt lässt Schering schließlich an Patienten testen. "Man hätte es aber nicht in so kleinen Einrichtungen wie in Kork machen dürfen", sagt Martin Friedrichs.
Dabei war Schering offenbar sogar bewusst, dass die Medikamente starke Nebenwirkungen haben. Offiziell warnt der Pharmakonzern 1973 in seinen "Medizinischen Mitteilungen Schering" davor, Cyproteronacetat an Jugendliche zu verabreichen. "Der Einfluss auf die Keimdrüsenentwicklung des jugendlichen Patienten vor Abschluss der Pubertät bedürfe noch weiterer Untersuchungen", heißt es darin. Auch der Verband forschender Arzneimittelhersteller (vfa) rät 1974 in der "Roten Liste" zur Vorsicht.
Der Triebhemmer solle nur verabreicht werden, wenn "die Betroffenen eingehend informiert und eingewilligt haben". Das Gegenteil passierte dann offenbar. Versuche mit Cyproteronacetat zur Triebhemmung gibt es nicht nur in den "Korker Anstalten". Auch in den "Rotenburger Anstalten" wird das Mittel ohne "Informierte Einwilligung" an Jugendlichen getestet, wie eine Expertenkommission Jahrzehnte später ermittelt.
Medikamentenversuche wie an KZ-Häftlingen sollten sich nicht wiederholen
Denn anders als in der "Diakonie Kork" hat der Vorstand der "Rotenburger Werke" die Geschichte der Einrichtung im Zeitraum 1945 bis 1975 aufarbeiten lassen - dazu zählen auch die Medikamententests an Heimbewohnern. 2018 veröffentlichte ein unabhängiges Forscherteam seinen Abschlussbericht. Darin ist zu lesen, dass der Triebhemmer ab 1969 in Rotenburg eingesetzt wurde - vier Jahre vor der Markteinführung. Als Mitglied des Teams hat die Pharmakologin Sylvia Wagner unter anderem einen Prüfbogen der Schering AG zu den Versuchen mit SH 8.0714 gefunden.
In den Patientenakten sei dokumentiert, dass an 13- und 14-jährigen Jungen täglich 300 Milligramm Cyproteronacetat verabreicht wurden. Dabei wäre bereits eine wöchentliche Dosierung von 300 Milligramm sogar bei Erwachsenen ausreichend für eine chemische Kastration gewesen. Bei einigen Jugendlichen wucherten daraufhin im Brustgewebe Tumore, sodass Teile davon amputiert werden. Abgesetzt wurde das Medikament nicht. Ärzte hätten die Substanz letztlich nach Gutdünken verabreicht, sagt Sylvia Wagner. "Ein unglaublicher Akt der Gewalt."
Tatsächlich widersprachen diese Behandlungsschritte den schon damals geltenden Forschungsprinzipien. Bereits nach dem Ende der Naziherrschaft verständigten sich internationale Ärzteorganisationen auf ethische Grundlagen in der klinischen Forschung. Etwas Vergleichbares wie die Euthanasiemorde oder die Medikamentenversuche an KZ-Häftlingen sollte sich nicht wiederholen. Maßgeblich bei Testreihen solle der Nutzen für den Patienten sein, eine umfassende Aufklärung durch den Arzt müsse erfolgen und es dürfe keine unnötige oder gar willkürliche Forschung am Menschen geben.
Letztlich aber wurden Probanden in der Bundesrepublik erst durch ein Arzneimittelgesetz, das 1978 in Kraft trat, besser geschützt. "Davor erhielten Versuchsteilnehmer keinerlei speziellen gesetzlichen Schutz durch den Staat", sagt Klaus Schepker, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie des Universitätsklinikums Ulm. Das Bundesgesundheitsministerium habe im "Arzneimittelgesetz" von 1961 und auch bei dessen Überarbeitung 1964 "auf jegliche Reglementierung für Pharmaunternehmen und Ärzte bei Medikamentenversuchen verzichtet".
Warum haben die Eltern von Schorsch nie geklagt?
Dennoch hätten die "Korker und Rotenburger Anstalten" von den Versuchsteilnehmern eine Einwilligung einholen müssen, um rechtlich auf der sicheren Seite zu sein, meint Schepker. "Wären die Sorgeberechtigten vor Ablauf der Verjährungsfrist vor Gericht gegangen, um eine mögliche Körperverletzung und Schadenersatzforderung klären zu lassen, wären die Chancen für Kork und Rotenburg gering gewesen."
Warum aber haben die Eltern von Schorsch nie geklagt? Drei Jahre hat es gedauert, um seine Angehörigen zu finden. Sommer 2018, irgendwo auf der Schwäbischen Alb. Auf einer Terrasse sitzt Schorschs Mutter, sie wirkt angespannt. Minutenlang schweigt sie, bevor sie zu reden beginnt. Anfang der Siebzigerjahre, erinnert sich die Mutter, wurden sie und ihr Mann ins Büro der "Korker Anstalten" gebeten. Die diakonische Einrichtung will ihren Jungen sterilisieren lassen. Die Eltern lehnen vehement ab. Über die Medikamentenversuche mit dem Triebhemmer erfahren sie in dem Gespräch nichts.
"Niemals hätten wir eingewilligt", sagt Schorschs Mutter heute. Von der Direktion wurden die Eltern auch dann nicht informiert, als ihr damals 18 Jahre alter Sohn in das Psychiatrische Landeskrankenhaus Schussenried eingewiesen wird.
Schorsch hatte vermutlich jahrelang jede Woche 350 Milligramm des Triebhemmers bekommen. Seine Sexualität wurde komplett ausgeschaltet. Erst 1976 in der Psychiatrie wurde das Medikament abgesetzt. Welche langfristigen gesundheitlichen Folgen Schorsch und die anderen Jugendlichen davongetragen haben, bleibt im Dunkeln. Nun ist Schorsch tot. Er starb 2012 im Alter von 55 Jahren.
Schorschs Familie fordert eine Aufarbeitung der Geschehnisse durch ein unabhängiges Forscherteam, um endlich mehr Licht in die Geschichte ihres Sohnes und seinen Leidensgenossen zu bringen. Es sei das Mindeste, was sie von der Diakonie Kork erwarten - wenn auch dadurch die Qualen der Jugendlichen nicht ungeschehen gemacht werden können. Immerhin: Der Vorstandsvorsitzende der Diakonie Kork, Frank Stefan, teilt mit, dass die Erinnerungen des Ersatzdienstleistenden Gebhard Stein für ihn inzwischen "plausibel" klingen.
Die fünfteilige SWR-Radioserie "Auf der Suche nach Schorsch" berichtet ausführlich über den Fall. Abzurufen auf der SWR-Website.