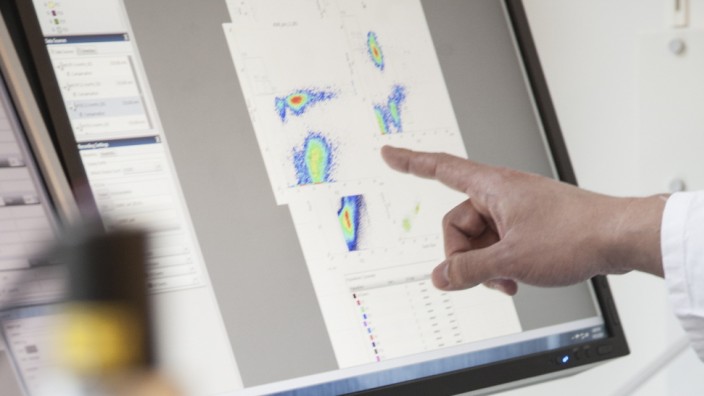Berlin, Charité. Der Arzt umfasst ihre Hand, drückt an den Knöcheln, zuerst an den oberen, dann wandert er die Finger hinab. "Keine Schmerzen?", fragt Tobias Alexander und schaut seine Patientin an. "Nein", sagt Petra Sperling. Sie lächelt. Der Chefarzt der Rheumatologischen Ambulanz wendet ihre gebräunte Hand und überprüft die Handfläche auf Schwellungen. "Schön", sagt er. Beide sehen sich in die Augen und lächeln, als könnten sie es immer noch nicht glauben.
Petra Sperling kommt gern hierher, ins Zimmer 03.039 eines der Backsteingebäude der Charité in Berlin-Mitte, in das die Sonne Lichtfetzen durch die Jalousien auf den Linoleumboden wirft. Die 67-Jährige mit der Kastenbrille und dem jugendlichen Pony weiß: Die Ärzte haben ihr nicht nur das Leben gerettet. Sie haben ihr etwas geschenkt, worauf sie nicht mehr zu hoffen wagte - ein Leben in Normalität.
Sperling hatte systemischen Lupus erythematodes, eine Rheuma-Erkrankung, die meist mit Gelenkschmerzen und Hautausschlag beginnt und in schweren Fällen mit Organversagen endet. Es erschien aussichtslos. Dass sie heute ihre Geschichte erzählen kann - und das völlig gesund - gleicht einem medizinischen Wunder. Es ist die Geschichte einer Wahnsinnstherapie, die hoffnungslosen Patienten neue Hoffnung gibt, aber mit großen Risiken einhergeht. Sperling musste erst durch die Hölle, um ihren Körper neu zu starten: "Damals hätte ich lieber sterben wollen."
Der Rheumatologe Tobias Alexander von der Berliner Charité.
(Foto: Annette Hauschild)Weltweit arbeiten Ärzte daran, Autoimmunkrankheiten zu besiegen. Medikamente können die Leiden oft verlangsamen - heilen können sie nicht. Seit Mitte der 1990er-Jahre erproben Hämatologen und Immunologen eine Therapie, mit der sie den Krankheitsverlauf ausbremsen, bei manchen sogar rückgängig machen wollen: den "Immunreset". Sie behandeln ihre Patienten als hätten diese Leukämie, mit Chemotherapie und Knochenmarkstransplantation. Die Idee dahinter: Ist das Immunsystem einmal ausgeschaltet, greift es den Körper nicht mehr an. Erst vor ein paar Wochen berichtete das Fachblatt New England Journal of Medicine über Patienten, die auch längerfristig von der radikalen Behandlung profitierten.
Noch steckt die Therapie wegen ihrer hohen Risiken in Deutschland in einer Nische. Nur Härtefälle werden behandelt und nur, wenn kein Medikament mehr hilft. Meist kommt die Methode in wissenschaftlichen Studien zum Einsatz, mal als eigens genehmigter Heilversuch. In Europa waren das in zwei Jahrzehnten 2000 Patienten. Fast die Hälfte von ihnen hatte Multiple Sklerose, ein Viertel Sklerodermie, eine Krankheit, bei der sich das Bindegewebe verhärtet. Und vier Prozent Lupus.
Petra Sperling war Mitte zwanzig, als sie merkte, dass etwas mit ihr nicht stimmte. Wenn sie morgens aufstand, um ihre Söhne zu wecken, spürte sie die steifen Gelenke. Anfangs achtete sie kaum darauf, die Schübe klangen ja wieder ab. Aber sie kamen wieder, wurden schlimmer. Wenn Sperling zur Arbeit fuhr, waren ihre Hände und Füße manchmal so geschwollen, dass sie weder den Schaltknüppel umfassen noch das Gaspedal treten konnte. Ihre Haut juckte, entzündete sich. Irgendwann begann ihr ganzer Körper zu schuppen.
Sie konnte vor Schmerzen kaum laufen und atmen. Niere und Herz waren angegriffen
Erst Mitte der 1990er-Jahre teilte ihr ein Rheumaspezialist, mit, dass sie an "Lupus" leide. Systemischer Lupus erythematodes ist selten und doch so etwas wie der Prototyp einer Autoimmunkrankheit. Immunzellen samt Antikörper kommen dann nicht nur gegen Eindringlinge wie Bakterien oder Viren zum Einsatz, wie bei gesunden Menschen. Bei diesen Patienten greifen Antikörper das körpereigene Gewebe an. Der Körper zerstört sich selbst.
Viele Betroffene können mit Medikamenten gut leben. Anderen dagegen scheint nichts zu helfen, wie bei Petra Sperling. Als sie 1996 die Charité betrat, konnte sie vor Schmerzen kaum laufen und atmen. Niere und Herz waren angegriffen. Die Ärzte versuchten, ihre fehlgeleitete Immunabwehr mit Medikamenten zu unterdrücken. Nichts schlug an. Nur Morphium linderte ein wenig die Schmerzen. Als die Ärzte sie fragten, ob sie an einer Studie teilnehmen wolle, dem Immunreset, zögerte Sperling nicht lange. Die Liste möglicher Nebenwirkungen umfasste vier Seiten: "Herzversagen", las sie da. Und "Lungenembolie". Doch habe es keine Alternative für sie gegeben, sagt Sperling: "Ich hab's gemacht, weil ich leben wollte."
In einem Glas-Ziegel-Bau des Deutschen Rheuma-Forschungs-Zentrums (DRFZ) auf dem Gelände der Charité hat Andreas Radbruch jahrelang nach den Ursachen von Autoimmunkrankheiten gesucht - und sie inzwischen gefunden: Gedächtniszellen, die falsch programmiert sind und deshalb fortwährend Autoantikörper produzieren. "Sie sind der Motor chronischer Entzündungen", sagt der wissenschaftliche Direktor des DRFZ. "Und wenn man das Immunsystem nicht neu startet, wird es keine Heilung geben." Bei Petra Sperling sah der Neustart so aus: Zuerst filterten die Ärzte alle Stammzellen aus ihrem Blut und deponierten sie in einer Tiefkühltruhe, für später. Nun folgte die Chemotherapie: Ein Cocktail aus Zellteilungshemmern und aus Kaninchen gewonnenen Antikörpern gegen menschliche Immunzellen vernichtete die krankmachenden Gedächtniszellen und mit ihnen Sperlings gesamtes Immunsystem.
Vier Jahre lang mied Sperling Kinos, Busse und Kaufhäuser
In den Wochen danach sah Sperling nicht viel mehr als Schläuche und die besorgten Blicke der Ärzte über dem Mundschutz. Auf der Isolierstation taten die Mediziner alles, um sie vor Infektionen zu bewahren. Antibiotika sollten Krankheitserreger in Schach halten. Die Luft im Einzelzimmer wurde gefiltert, ihr Essen hoch erhitzt. Nach der Chemotherapie holten die Ärzte ihre Stammzellen aus der Tiefkühltruhe und legten mit einer Infusion die Basis für den Wiederaufbau ihrer Abwehrkräfte. Zu Hause hatte Sperling zunächst Mühe, die Treppe hinauf in den dritten Stock zu gelangen. Vier Jahre lang ging Sperling nicht ins Kino, mied Busse und Kaufhäuser, Türklinken drückte sie mit dem Ellenbogen runter. Bis heute hat sie stets ein Desinfektionsmittel dabei.
Die Abwehrkräfte kehrten zurück, reagierten anfangs nur zögerlich auf Keime. Gefürchtet sind vor allem Herpes-Viren oder Hefe-Pilze. Wenn die sich ungebremst ausbreiten, ist der Körper machtlos, wie bei jener Patientin damals, im Jahr 2002, daran erinnert sich Studienleiter Tobias Alexander genau. Nach dem Immunreset ging es ihr schlechter und schlechter. Zu spät fanden die Ärzte den Grund: Ein Pilz hatte sich im Gehirn der Frau ausgebreitet, sie war nicht mehr zu retten.
Alexander fragte sich damals, ob sie ein zu hohes Risiko eingegangen waren. Der Mediziner weiß aber auch, dass er mit der Therapie vielen Patienten das Leben gerettet hat. Mehr als die Hälfte von ihnen verlässt die Klinik, ohne Medikamente zu brauchen. Selbst wer einen Rückfall hat, spricht wieder auf Arzneimittel an. Und was wäre die Alternative? "Wenn man diese schwerkranken Patienten nicht behandelt, sterben sie", argumentiert Alexander.
Viele Experten sind skeptisch
Doch viele Rheumatologen und Neurologen stehen der Therapie reserviert gegenüber. Zwar funktioniert die Abschirmung gegen Pilze und Keime heute besser als zur Zeit jenes Todesfalls, die Dosis der Chemotherapie ist geringer, die Behandlung weniger belastend. Die Mortalitätsrate ist europaweit von 13 auf sechs Prozent gesunken - ein Fortschritt, aber immer noch ein hoher Wert. An der Berliner Charité wurden bislang 22 Menschen behandelt. Drei sind gestorben. Alexander überlegt deshalb genau, wem er die Teilnahme an der Immunreset-Studie anbietet.
Tübingen, Uniklinik. Auch Jörg Henes muss genau hinsehen, wenn Patienten bei ihm vorsprechen. Der Leiter der Abteilung für Rheumatologie hat deutschlandweit die meisten Patienten mit der Immunreset-Therapie behandelt - etwa 65. Er hat sich auf Sklerodermie spezialisiert, eine Autoimmunkrankheit, die Haut und Organe verhärtet. Wer zu lange gewartet hat, bis er zu Henes kommt, für den kann es zu spät sein - die Organe sind oft schon zu strapaziert für die Tortur des Immunresets. "Je kränker die Patienten sind, desto höher sind die Gefahren der Therapie", sagt Henes. "Einige Patienten sind eigentlich schon zu krank. Da sie aber keine Alternative haben, gehen sie das Risiko ein."
Das erklärt, warum jeder zehnte Sklerodermie-Patient die Therapie nicht überlebt. Für Ärzte wie Henes ist es eine Gratwanderung. Sie wollen Patienten nicht abweisen, die auf ein normales Leben hoffen können. Aber sie wissen auch, dass es mit jedem Todesfall schwieriger wird, die Immunreset-Therapie als Behandlung für besonders kranke Patienten durchzusetzen.
Viele Patienten können nach der Therapie wieder besser gehen und flüssiger sprechen
Chicago, Northwestern Memorial Hospital. Im 16. Stock des Beton-Glas-Hochhauses hat Richard Burt eine ganze Station mit 40 Betten eingerichtet, nur für Patienten mit Autoimmunkrankheiten. Tausende von ihnen hat der Leiter der Abteilung für Immuntherapie bis heute behandelt, so viele wie kein anderer. Vor allem Patienten mit Multipler Sklerose, einer Krankheit, bei der das körpereigene Abwehrsystem die Nervenhüllen in Gehirn und Rückenmark angreift. Mehr als drei Viertel der Patienten bleiben in den ersten vier Jahren nach dem Immunreset ohne Rückfall, viele können wieder besser gehen und flüssiger sprechen, so ergab eine Studie an insgesamt 145 Probanden in der Fachzeitschrift Jama im Jahr 2015. Kein MS-Medikament der Welt ist so durchschlagend. Daher steht die Therapie in den USA inzwischen kurz vor dem Durchbruch. Die gewagte Vision von Richard Burt: Wer nicht auf Erstmedikamente anspricht, der bekommt in Zukunft seine Behandlung, in Spezialzentren, weltweit. "Sie hat das Potenzial, den meisten Menschen mit Multipler Sklerose zu helfen", sagt er.
Burt will seine Kritiker - die Neurologen im ganzen Land - mit etwas überzeugen, was Mediziner den Goldstandard nennen: eine kontrollierte Studie an Patienten, die nach dem Zufallsprinzip auf zwei Gruppen verteilt werden. Die eine Hälfte bekommt die echte Therapie, die andere muss weiter MS-Medikamente schlucken oder spritzen. Erst dadurch zeigt sich, wie wirksam eine Therapie wirklich ist. Bis Ende des Jahres möchte der 60 Jahre alte Immunologe alle Ergebnisse haben.
Immerhin ist von seinen MS-Patienten bisher keiner an der Behandlung gestorben. Das liegt nicht nur daran, dass diese - anders als bei Sklerodermie oder Lupus - meist intakte Organe haben. Burt wählt seine Patienten zudem penibel aus, überwacht sie im Krankenhaus rund um die Uhr und dosiert die Chemotherapie niedrig, schaltet also das Immunsystem der Patienten - im Gegensatz zu seinen Kollegen in Tübingen und in Berlin - nicht vollständig aus. Doch ein Risiko bleibt.
Darum der breite Widerstand der Neurologen. Sie wollten Patienten, die nicht unmittelbar vom Tod bedroht seien, nicht einer potenziell lebensgefährlichen Therapie unterziehen, glaubt Burt. Für Neurologen zählten in erster Linie Lebensjahre. Für die Patienten aber kommt es auf die Lebensqualität an. Für viele MS-Kranke ist die Frage nicht, wie weit sie ihren Tod hinauszögern können. Sie wollen ihr altes Leben zurückbekommen.
Sie konnte nicht länger als fünf Minuten stehen - heute tanzt sie wieder
Wie bei Sandra Rascher. Die Medizintechnikerin war von München nach Kalifornien ausgewandert, spürte dort im Sommer 2009, wie ihre Hände taub wurden, spürte ein Kribbeln, das sich entlang der ganzen Wirbelsäule ausbreitete. Nach fünf Monaten hatte sie die Diagnose: MS. Rascher musste sich jeden Tag einen Immunblocker in Bauch oder Po spritzen. Trotzdem bekam sie zwei weitere Schübe, konnte danach nicht mehr länger als fünf Minuten stehen. Kortison ließ die Schübe zwar abklingen, aber es blieb immer etwas zurück: Sie wurde müder, ihr wurde öfter schwindlig. "Mein Körper hat nicht mehr funktioniert", sagt sie.
Tagelang stöberte sie im Internet, fand die Studie von Richard Burt - und bewarb sich, mit Erfolg. Dann folgten: Chemotherapie, Stammzelltransplantation, drei Wochen Isolation im Krankenhaus. "Der ganze Prozess ist anstrengend, aber machbar", sagt Rascher. Nach ein paar Monaten merkte sie, wie ihr Körper wieder zu Kräften kam, nach einem Jahr konnte sie wieder gehen, selbst tanzen kann sie wieder.
Burt glaubt, dass die meisten seiner Patienten von Rückfällen verschont bleiben. So sei das bei seinen ältesten Patienten gewesen, die er vor 15 Jahren behandelt hat. Was aber nach 20, 30 oder 40 Jahren passiert, weiß auch er nicht, ebenso wenig wie Henes oder Alexander. Mit der Ungewissheit müssen die Patienten leben - erst die nächste Generation wird darauf Antworten bekommen. Und zwar von Menschen wie Sandra Rascher oder Petra Sperling.