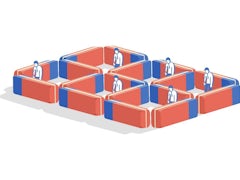Seit dem Votum für den Brexit und dem Sieg Trumps ist die Rolle, die soziale Medien für Populisten spielen, kaum noch zu überschätzen. Wie immer die Wahlen im nächsten Jahr in den Niederlanden, in Frankreich und in Deutschland ausgehen werden - Geert Wilders, Marine Le Pen und die AfD können sich auf die enormen Chancen freuen, die vor allem Facebook ihnen bietet.
Schon nach der philippinischen Präsidentschaftswahl im letzten Mai beschrieb die südostasiatische Zeitung New Mandala, "wie Duterte die Wahl auf Facebook gewann". In Deutschland folgen zur Zeit rund 305 000 Menschen der AfD-Seite auf Facebook, während es die CDU nur auf 123 000 Nutzer, die SPD auf 120 000 bringt. Etwa um das Zehnfache überragt die Zahl der Fans, die in Frankreich Marine Le Pen folgen, die Anzahl der Facebookfans des Präsidenten François Hollande.
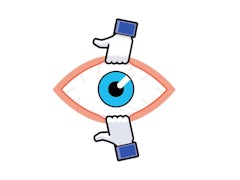
Facebook verrät nicht, nach welchen Kriterien Inhalte entfernt werden müssen. Dem SZ-Magazin liegen Teile der Regeln vor. Wir zeigen Ausschnitte und erklären sie.
"Facebook", sagt der Politikwissenschaftler Richard Heydarian, "verhalf nicht den Durchschnittsbürgern zu mehr Macht, sondern professionellen Propagandisten, Leuten an den politischen Rändern und Verschwörungstheoretikern. Stimmen, die sich bisher im Verborgenen hielten, tönen jetzt im Zentrum des öffentlichen Diskurses." Dabei ist es nur wenige Jahre her, dass soziale Medien als demokratisches Versprechen galten. 2012 goss Mark Zuckerberg in seinem "Letter to Investors" Zweck und Prinzipien seines Netzwerkes in diese erhabenen Sätze:
"Facebook wurde als soziale Mission gegründet - um die Welt offener und vernetzter zu machen."
"Wenn Leute mehr miteinander teilen, entsteht eine offenere Kultur und ein besseres Verständnis für das Leben und die Sichtweisen anderer."
"Wir glauben, dass die Hilfestellung, die wir Leuten bieten, um ihre Interessen zu teilen, zu einem aufrichtigeren und transparenteren Dialog über die Regierung führt und damit zu direkterer Handlungsmacht (empowerment) der Leute, zu erhöhter Rechenschaft der Hoheitsträger und zu besseren Lösungen der größten Problem unserer Zeit."
Zuckerbergs Motive spielen keine Rolle mehr
Vier Jahre später wissen wir, dass es gar nicht mehr darauf ankommt, ob Zuckerberg tatsächlich je von dieser Idee der Weltoffenheit beflügelt wurde oder primär von profaneren unternehmerischen Zielen. Entscheidend ist nicht die Motivation des Gründers, entscheidend ist die strukturelle Dynamik des Netzwerkes selbst.
Und diese Struktur ist, bei aller Komplexität der eingesetzten Algorithmen, denkbar einfach und gradlinig: Mag das Netzwerk inzwischen 1,8 Milliarden Mitglieder umfassen, so sind die Linien der Vernetzung primär auf überschaubare Freundeskreise und Geistesverwandtschaft eingestellt, auf Personalisierung, auf private Definition des Kommunikationsumfelds, auf Sympathiezuordnung und Andocken an Nutzer ähnlicher Sinnesart.
Nichts könnte dieser Eingrenzungslogik ferner liegen als menschheitsübergreifende Foren für die "größten Probleme unserer Zeit". In dem Maße, in dem die Kommunikationsangebote auf Vertrautheit, Einverständnis und Gruppenbildung setzen und damit alternative oder gar konträre Weltsichten von einander fernhalten, erledigen sich nicht nur alle Ideen von Weltbürgertum oder Völkerverständigung, sondern auch alle Ideen von einer wenigstens die jeweilige Nation übergreifenden Verständigung.
"Jeder sieht nur, was er sehen will"
In diesem Sommer hat Facebook den Algorithmus seiner Newsfeeds noch einmal gruppenspezifisch drastisch verschärft. Hatte man zunächst Zeitungshäuser damit umworben, sich auf das Netzwerk einzulassen, um dort ihre Leserschaft zu finden und zu erweitern, zieht der erneuerte Algorithmus bei den einzelnen Nutzern hauptsächlich solche Posts und News nach vorne, die von Freunden und Familienmitgliedern eingestellt werden. Damit haben herkömmliche Medien das Nachsehen, vor allem aber verengt sich der Horizont der Nutzer weiter. Tucholskys Sentenz, "jeder sieht nur, was er sehen will", könnte der Leitspruch von Facebook sein.
Der von vielen beklagte Effekt sozialer Filterblasen war daher nie eine ungewollte Nebenwirkung, sondern von Anfang an einkalkuliert. Neu ist allenfalls, dass er von Jahr zu Jahr deutlicher sichtbar wird. Nicht dass es an Stimmen mangeln würde, die den Filtereffekt der sozialen Medien in Frage stellen. Als Beleg führt man vor allem zwei prominente Analysen von britischen und amerikanischen Statistikern an, nämlich die Studie "Filter Bubbles, Echo Chambers, and Online News Consumption" von Seth Flaxman und Kollegen (April 2016) und die Studie der Gruppe um Eytan Bakshy: "Exposure to ideologically diverse news and opinion on Facebook" (Juni 2015). Tatsächlich aber widerlegen beide Studien den "Echokammer-Effekt" in sozialen Netzwerken nicht, im Gegenteil.

Nach dem Sieg von Donald Trump richtet sich die Wut gegen die "Filterblase" in sozialen Netzwerken. Dabei missverstehen viele die Natur dieses Phänomens.
"Wir finden starke Beweise dafür", konstatieren Flaxman und seine Kollegen, "dass Individuen nur solche Publikationen lesen, die einander ideologisch ähneln, kaum aber solche mit konträren Perspektiven." Und dieses Fazit gilt, obwohl das Datenmaterial der Flaxman-Studie bereits von 2013 stammt, das der anderen von 2014. Dass Facebook inzwischen die Algorithmen für die Nachrichtenauswahl noch sehr viel restriktiver auf den Umkreis der Nutzer zugeschnitten hat, ist also noch gar nicht berücksichtigt.
Berücksichtigt ist auch noch nicht die explosive Zunahme von Falschmeldungen und Hassrhetorik. Doch gerade das kumulative Zusammenspiel von Echokammern, Unwahrheiten und Hetzangriffen fördert die Segregation von Gesinnungswelten erst recht. Farhad Manjoo, der amerikanische Spezialist für neue Medien und Medientechnologien, der schon lange vor der jetzt in Mode gekommenen Phrase von der post-faktischen Kommunikation sprach ("True Enough: Learning to Live in a Post-Fact Society", 2008), scheut sich heute nicht mehr, den sozialen Medien eine "welterschütternde Macht" zuzuschreiben.
Seine Sorgen scheinen kaum übertrieben. Natürlich sind die sozialen Medien nicht die Ursache für die Krise der traditionellen Medien, für die Abstiegssorgen der Mittelklassen, für die zunehmende Attraktivität autoritärer Regime oder für sonstige mentale Destabilisierungsprozesse in so vielen Ländern. Aber sie haben das Potential, diese Prozesse hochzuschaukeln, indem sie polarisierten Geistern getrennte kommunikative Sammelbecken liefern, indem sie in den eingehegten Schonräumen politische und rhetorische Enthemmung erleichtern und indem sie gemeinsame Wahrheitsfindung entwerten.
Netzwerke wie Facebook behindern vernunftorientierte Kommunikation
"Das Internet manifestiert sich heute nicht mehr als öffentlicher Raum, als ein Raum des gemeinsamen, kommunikativen Handelns", schrieb 2013 der Philosoph Byung-Chul Han, "es zerfällt vielmehr zu Privat- und Ausstellungsräumen des Ich." Nicht zufällig verwendet Han hier den Habermas'schen Begriff des "kommunikativen Handelns". Der besagt, dass im Idealfall Demokraten einander nicht nur egalitär, herrschafts- und täuschungsfrei begegnen, sondern vor allem, dass ihre Kommunikation verständigungs- und vernunftorientiert ist; die besseren Argumente sollen überzeugen.
Dieses idealtypische Modell scheint ein Netzwerk wie Facebook geradezu verhindern zu wollen: privatisierte politische Sprachen, Barrieren zwischen den Perspektiven, Vorrang von Emotion vor Sachlichkeit und Neutralität, politischer Separatismus, Hermetik statt gemeinsamer Hermeneutik, Sturm und Drang statt praktischer Vernunft.
Dieter von Holtzbrincks Feststellung, dass "die Autokraten dieser Welt sich dieses Mediums bemächtigt haben und es intelligent anwenden" ( Handelsblatt vom 30.11.2016), gibt deshalb nur die eine Seite der Medaille wieder. Denn Voraussetzung für die "intelligente" Nutzung von Facebook durch Autokraten ist ja, dass sich Facebook dafür hergibt. It takes two to tango. Warum passen der autoritäre Anspruch von Autokraten und der tausendfach zersplitterte, antiautoritäre Reflex der Nutzer zusammen? Wenn die Nutzer in Facebook ihrem Eigensinn und Abgrenzungsverlangen freien Lauf lassen können - was ist das für ein Eigensinn, was für ein Identitätsanspruch, der sich an Autokraten abtreten und delegieren lässt? Wie auch immer diese Paradoxie zu erklären ist, sie kann nur funktionieren auf Kosten von Offenheit und Respekt vor Andersheit.
Lüge hat tausend Gesichter, Wahrheit nur eines
In der Tat, im Gegensatz zu Zuckerbergs Credo in seinem oben zitierten Investorbrief, dass das Netzwerk dem "besseren Verständnis für das Leben und die Sichtweisen anderer" diene, verhält es sich umgekehrt: Facebook ist das Massenmedium, das es allen Beteiligten erlaubt, von den Sichtweisen der anderen verschont zu werden. Mehr noch, es schafft genau die Fremdheit, die man dann aggressiv ablehnt.
Folgerichtig ist in sozialen Medien die politischen Korrektheit noch verpönter als in den meisten traditionellen Medien. In den Tagen nach der Ermordung der Labour-Abgeordneten Jo Cox haben auf Twitter mehr als 50 000 Nutzer den Mord gefeiert und den Mörder zum "Helden" oder "Patrioten" erhoben; von Facebook sind die Zahlen hierzu nicht erfasst, dürften aber ähnlich krass sein.

Das Unternehmen entwickelt sich zur größten Plattform für Hass, Hetze und Desinformation. Mark Zuckerberg muss handeln, sonst scheitert seine große Vision.
Und folgerichtig ist ebenso, dass sich so viele Nutzer vom Wahrheitsanspruch lossagen. Fakten anzuerkennen, heißt ja im Zweifel, sie mit Andersdenkenden, Fremden, Andersgläubigen teilen zu müssen. Doch ein Medium wie Facebook ist de facto ein Netz von Inklusionen und Exklusionen, kein Netz, das Gemeinsamkeit durch Vernunft und Wahrhaftigkeit erzwingt.
"Die Lüge impliziert Freiheit", hielt Hannah Arendt in ihrem "Denktagebuch" fest, "die Wahrheit zwingt zur Einsicht." Lüge hat bekanntlich tausend Gesichter, Wahrheit nur eines. Und wo missfallende Tatsachenbehauptungen dann doch nicht aus der Welt zu schaffen sind, erklärt man sie zu bloßen Meinungen der Gegner. Auf diese Weise lassen die diversen Echo- und Meinungskammern der sozialen Medien eigene politische Realitäten entstehen, die untereinander keinen verbindlichen Wirklichkeitsbezug teilen. Da passt der geniale Begriff "Entwirklichung", ebenfalls von Hannah Arendt.
Vor allem dieser Zug zur Entwirklichung macht soziale Medien für Populisten so anfällig. Würden Populisten nur Wut und Ängste oder patriotischen Furor aufwiegeln, wäre das schon gefährlich genug. Doch richtig leicht wird es ihnen von Massenmedien gemacht, in denen gemeinsame Wahrheiten obsolet sind.