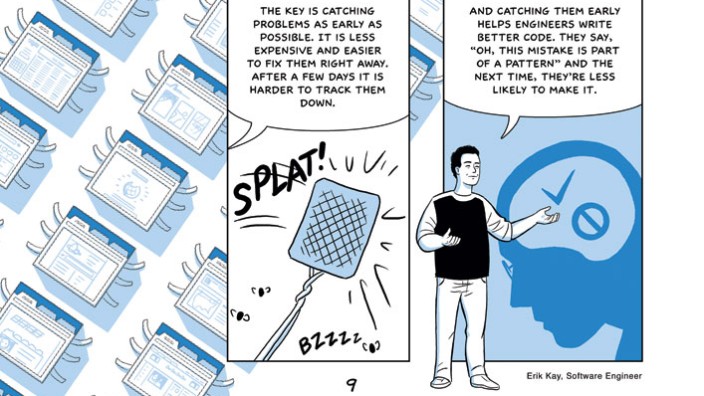Ganz zufällig sickerte damals ein Comic durch. Es zeigte die Welt, wie Google sie sich vorstellt: Auf 38 Seiten lümmelten erschöpfte Programmcodes auf dem Sofa, krochen Schädlinge auf die Systeme, zogen düstere Gestalten durchs Bild. Mittendrin: die Jungs von Google. Der Schlag von Menschen, der einem wirklich helfen will - statt immer nur teure Softwarepakete zu verticken. Der Schlag von Mensch, den man einfach mögen muss. Die Jungs entwarfen den Internetbrowser Chrome.
Fünf Jahre ist das nun her. Und so putzig dieses Comic auch wirkte, es war eine Kriegserklärung. Gegen Microsoft. Und Google sollte es in seinem Feldzug gegen den Softwarekonzern weiter bringen als die meisten anderen Rebellen zuvor.
Der erste dieser kleinen Rebellen war ein Student namens Marc Andreessen. Binnen weniger Wochen schrieb er im Jahr 1993 ein paar Tausend Zeilen Programmcode. Im Grunde genommen war es ein mickriges Stück Software. Aber doch ein Wunderding. Mit diesem Programm konnte man sich das Internet anschauen, dieses Wirrwarr, das damals nur aus Buchstaben bestand, fast ohne Bilder. Einige Entwickler um Andreessen machten sich ein Jahr später an den Browser Netscape. Und je mehr Menschen das Internet entdeckten, desto mehr Menschen entdeckten auch Netscape. Es war schlichtweg der beste Weg, um in diese neue Welt vorzudringen.
Microsofts Neid
Einen, der damals in Sachen Software das Sagen hatte, musste solch eine Erfolgsgeschichte neidisch machen: Microsoft. Und der Konzern hatte seine Möglichkeiten, es dem aufstrebenden Start-up schwerzumachen. Sein Betriebssystem Windows läuft noch immer auf neun von zehn Rechnern. Und passend dazu bietet Microsoft nicht nur Programme zur Textverarbeitung und zur Tabellenkalkulation, sondern auch zum Surfen im Netz. Mit brachialer Gewalt drückte der Konzern Netscape nieder: All den zähen Gerichtsverfahren, den verhängten Milliardenstrafen, den strengen Auflagen zum Trotz wurde binnen kurzer Zeit ein neuer Browser zum wichtigsten Werkzeug fürs Netz: der Internet Explorer von Microsoft. Erst 2010 ordnete die EU-Kommission an, dass Microsoft all jenen, die auf ihrem PC das Betriebssystem Windows nutzen, auch Zugang zu anderen Browsern gewähren muss.
Wer den Browser stellt, der hat auch einen guten Einblick in die Gewohnheiten der Menschen, die im Netz unterwegs sind. Noch etwas besser geht es demjenigen, der Browser und Suchmaschine stellt. Und damit wiederum kannten sich zwei andere Studenten ziemlich gut aus, die ihrerseits an Programmcodes tüftelten, ein paar Jahre nach Andreessen. Sie hießen Larry Page und Sergej Brin. Ihr Projekt: Google. Je größer das Internetunternehmen mit seiner Suchmaschine wurde, desto unruhiger wurde Microsoft. Um seiner eigenen Maschine namens Bing den nötigen Schwung zu verleihen, wollte der Softwarekonzern sogar mal Yahoo übernehmen. Vergeblich.
Heute in vielen Ländern dominant: Chrome
(Foto: SZ-Grafik: Michael Mainka)Google und Microsoft: zwei widerstreitende Weltanschauungen
Google und Microsoft. Das sind nicht nur zwei konkurrierende Konzerne, sondern auch zwei widerstreitende Weltanschauungen. Microsoft will weiterhin Software verkaufen, weshalb dem Konzern lange daran gelegen war, dass das digitale Leben seiner Kundschaft auf den eigenen Computer beschränkt bleibt. Google hingegen machte sich daran, die Festplatten der Menschen zu entrümpeln. Textverarbeitung und Tabellenkalkulation sollte in der digitalen Wolke stattfinden. Dazu brauchte Google eine Art Knotenpunkt. Und das sollte Chrome sein. Nebenbei diente der Browser auch als lukrative Werbetafel. Denn mit den Anzeigen im Netz macht Google sein Geld. Deshalb kann der Konzern den Kunden all seine Programme auch kostenlos anbieten.
Wer den Internet Explorer nutzen will, muss vor allem Geld zahlen. Wer Chrome nutzen will, muss auch bezahlen - allerdings mit Informationen über seine Gewohnheiten im Netz. Es gibt aber auch eine Möglichkeit, durch die Weiten des Internets zu steuern - ohne zu zahlen. Firefox heißt der Browser, der kostenlos ist und dennoch auf den Schutz der Privatsphäre setzt. In Deutschland ist er noch immer so beliebt wie kein anderer Browser. In Amerika hat Chrome ihn mittlerweile verdrängt.
Firefox haben Tausende Entwickler weltweit gemeinsam geschrieben. Zumeist in ihrer Freizeit. Es ist eine offene Plattform. Jeder darf sich einbringen - und niemand darf dabei Geld verdienen. Hinter dem Programm mit dem Fuchs, der sich um die Weltkugel schmiegt, steht die gemeinnützige Mozilla-Stiftung. Sie hat es sich zum Ziel erklärt, die trägen Konzerne in Schach zu halten - zum Wohl des Kunden. So hat die Mozilla-Stiftung vor zwei Jahren auch den Do-not-track-Button erfunden, den die amerikanischen Behörden gegen den Widerstand aus der Technologie- wie aus der Werbebranche zur Pflicht für alle Browser machte. Mit diesem Knopf kann jeder, der im Netz unterwegs ist, seine Spuren verwischen. Werbevermarkter können dann nämlich nicht mehr verfolgen, dass der Einzelne erst bei Amazon ein Buch bestellt, dann bei Zalando ein Paar Schuhe betrachtet - und schließlich auf der Seite mit den neuesten Kosmetikprodukten von Nivea den Gefällt-mir-Knopf angeklickt hat.
Doch auch der Firefox muss den Leuten im Netz bei der Suche nach Informationen helfen - und hat deshalb die Suchmaschine zum Standard auf der Startseite gemacht, die am besten weiß, was die Menschen im Netz suchen: Google. Im Gegenzug überweist der Internetkonzern Geld an die Stiftung.
Schauplätze verschieben sich
Je mehr Menschen sich allerdings nicht mehr vor einen Rechner setzen, um im Internet zu stöbern, desto stärker verschieben sich die Schauplätze, auf denen die Anbieter miteinander ringen. Es geht nicht mehr nur um die Vorherrschaft auf dem PC, sondern mehr und mehr um die Vorherrschaft auf Smartphones und Tablets. In einer Welt, in der unterwegs im Netz gesurft wird, verliert der Browser an Bedeutung. Denn der Haupteingang ins mobile Internet sind die Apps.
Google hat es sehr geschickt verstanden, sich mit seinem mobilen Betriebssystem Android in dieser Welt als wichtige Schaltstelle zu etablieren. Android läuft auf drei von vier verkauften Smartphones weltweit. Wer sich dort eine App herunterlädt, kommt um Google nicht herum. Manchen ist diese Macht unheimlich. Aber es gibt bereits kleine Rebellen, die auch in der neuen Welt des mobilen Internets den Kampf gegen die Großen aufgenommen haben.
Die Mozilla-Stiftung ist vor Kurzem mit einem mobilen Betriebssystem angetreten - und dem Vorsatz, sich zum Wohle des Kunden auch mit den neuen Machthabern in der mobilen Internetwelt anzulegen. Der südafrikanische Milliardär Mark Shuttleworth, der sich selbst als "wohlwollenden Diktator" bezeichnet, hat mit Ubuntu Ähnliches vor.