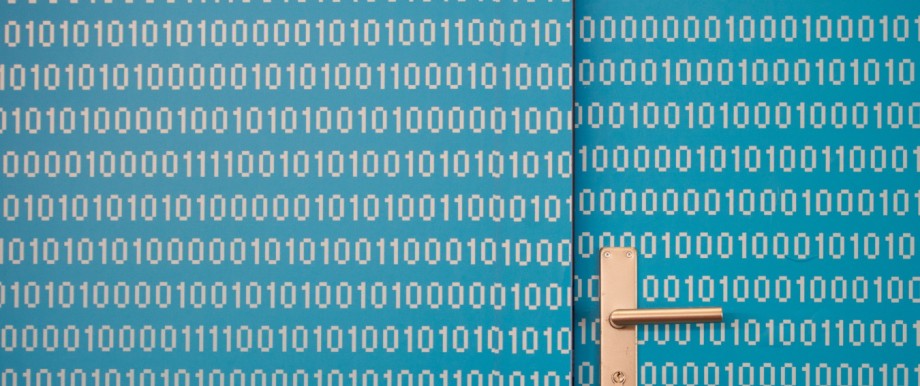Kurzer Blick in den Alltag: Heute schon was im Internet gesucht? Eine Nachricht verschickt? Bilder geguckt? Womöglich auf einem handtellergroßen Gerät? Der Komiker Louis C.K. beschrieb das mal als reine Magie. Dankbar sollte man sein, dass da etwas unsichtbar für einen arbeitet und in Sekundenbruchteilen erledigt, wofür man früher Stunden brauchte. Es ist im Jahr 2014 natürlich eine Binse, dass es die Algorithmen sind, die das tägliche Leben bestimmen. Meist war es großer Ärger, der sie ins Gespräch brachte - Google, Amazon, NSA. Alles weltumspannende Algorithmusmaschinen. Nur - wer weiß schon, was ein Algorithmus ist?
Es gibt gewichtige Gründe, sich jetzt und sofort damit zu beschäftigen, auch wenn die Mathematik zu den Wissenschaften gehört, die der Alltag und das Leben nach dem Schulabschluss in unergründliche Tiefen des Gedächtnisses verräumen. Die Gründe gehen weit über den Ärger mit Google, Amazon und NSA hinaus. Es hilft, wenn man die Mathematik als Sprache versteht. Denn es gibt eine neue Weltsprache - die Sprache der Maschinen. In dieser Sprache sind Algorithmen das Element, das die Entscheidungen fällt.
Noch ein Vergleich: Die Sprache, die in einer Gesellschaft die grundsätzlichen Entscheidungen fällt, ist die Sprache der Gesetze. Und hier liegt auch gleich der Grund, warum es so wichtig ist, sich mit der neuen Weltsprache auseinanderzusetzen. Sowohl Gesetze wie Algorithmen werden von Menschen geschrieben. Der Unterschied liegt darin, dass die Gesetze der kollektive Ausdruck einer Gesellschaft sind. Soziale Veränderungen und vor allem Werte formen Gesetze. Algorithmen aber werden von Ingenieuren geschrieben. Die sind keine Vertreter der Gesellschaft, sondern handeln im Dienst eines Instituts, einer Firma, eines Geheimdienstes oder auch nur für sich selbst. Wenn aber Algorithmen in der Welt der Maschinen die Sprache der Entscheidungen bilden, tut eine Gesellschaft gut daran, sich mit ihr zu beschäftigten.
Sprache des Rechts muss für eine Jury aus Laien verständlich gemacht werden
Kurzer Selbstversuch - das "Taschenbuch der Algorithmen", ein Lehrbuch, das es Studenten der theoretischen Informatik leicht machen soll, sich in diese neue Sprache einzufinden. Die Frustration kommt ähnlich rasch, wie bei Versuchen, Arabisch zu lernen, Chinesisch oder was einen sonst für Flausen reiten, sich aus dem indogermanischen Sprachraum zu entfernen. Da muss man offensichtlich erst einmal die nötigen Hirnwindungen zurechtbiegen, um nur eine Ahnung zu bekommen.
Man sucht also noch einfachere Bilder. Algorithmen sind mathematische Gleichungen, die in ihrer Summe ein Problem lösen. Das geht Schritt für Schritt. Betrachtet man ein Computerprogramm also als Maschine, wären die Programmiersprachen Gehäuse, Hebel, Kupplungen, die Algorithmen aber Zahnräder. Sie greifen ineinander, setzen die erste Mechanik in Bewegung, die zweite, die Maschine nimmt Fahrt auf und voilà - Google hat gerade herausgefunden, dass der Gauchotanz der Nationalelf irgendwie nicht in Ordnung war, aber dann wieder doch.
Oder vielleicht sucht man besser nach einem Video des Künstlerduos Fischli & Weiss, die mit ihrer Skulpturenserie "Der Lauf der Dinge" so etwas wie einen dadaistischen Algorithmus aus allerlei Materialien geschaffen haben. Da stoßen ein paar Reifen auf Metallringe, die ein Wasserrad in Gang setzen, das eine Platte kippt, auf der eine Dose ins Rutschen kommt, die ein Wägelchen mit zwei Klingen anschiebt und so weiter - rund zehn Minuten dauert der Ablauf, dem man mit Staunen folgt. So, wie man vermutlich mit Staunen einem Algorithmus folgen würde, verliefen die unzähligen Rechnungen nicht im Nanosekundentakt.
Algorithmen sind auch ein großes Geheimnis
Nun ist auch die Sprache des Rechts ein schwieriges Gefilde, das nur Studierte durchblicken. Die Entscheidungen treffen hier Richter. In Amerika tun sie das gemeinsam mit einer Jury. Und weil die amerikanischen Anwälte und Richter diese Sprache für die Jury aus Laien verständlich machen müssen, ist das Genre das Gerichtsdramas so spannend, die Romane von John Grisham, Filme wie "Die zwölf Geschworenen", Serien wie "Suits". Das macht das Verstehen leichter.
Es ist aber nicht nur so, dass Algorithmen nicht physisch oder logisch nachvollziehbar sind, sie sind auch ein großes Geheimnis. Nur selten geschieht es, dass Experten wie der Hacker Jacob Appelbaum den Quelltext aus einer großen Organisation wie der NSA einsehen können, wo er neulich den Skandal herauslas, dass schon jeder verdächtig ist, der versucht, sich im Netz zu schützen. Der Algorithmus von Google beispielsweise, der bestimmt, welche Suchergebnisse auf den wertvollen Plätzen der ersten Bildschirmseite erscheinen, wird bekanntlich so streng gehütet wie das Rezept der Coca Cola. Wobei dieser Vergleich hinkt. Die Konsistenz des Cola-Sirups mag ein Betriebsgeheimnis sein. Der Google-Algorithmus ist eher so etwas wie eine Fatwa. Algorithmen sind fundamentalistische Grundsatztexte, die eherne Regeln schaffen. Die verändern sich höchstens aus sich selbst heraus, weil Computer das Lernen gelernt haben. Als Normalnutzer hat man auf sie nur wenig Einfluss.
Das ist im Alltag auch gut so. Einer der größten Fortschritte der digitalen Kultur war die grafische Benutzeroberfläche. Steve Jobs erkannte das als erster Konzernchef. Bis zum Apple Computer musste man sich mit seinem Computer über eine ungelenke Befehlssprache namens MS-Dos verständigen. Was für ein Fortschritt war es, als Apple die Karikatur eines Schreibtisches als Vermittler etablierte. So kann jeder bis heute seine Dateien herumschieben wie einen Stapel Akten im Büro. Die Grundkenntnisse der neuen Weltsprache gingen dabei allerdings so rasch verloren wie Latein und Altgriechisch.
Das wird sich ändern. In einigen Ländern wie Estland, Israel und Bayern behandeln die Lehrpläne von der Grundschule bis zur Universität Coding wie eine Fremdsprache. In den USA lancierte Präsident Obama die "Hour of Code"-Initiative für Schulen. In Großbritannien wird das Programmieren ab September zum Pflichtfach. Noch sollen diese Initiativen die Schüler auf eine Arbeitswelt vorbereiten, in denen Programmiersprachen so wichtig sein werden wie bisher die Handelssprachen.
Längst gibt es Forscher, die humanistische Werte in Algorithmen verankern
Bis diese Inititiativen in der breiten Bevölkerung greifen, wird es auch Jahre dauern. Die ersten Schritte aus den Wissenschaften und Laboratorien der digitalen Welt sind schon getan. Im digitalen Untergrund von Berlin, jenem grandiosen Gegenmodell zum hyperkapitalistischen Silicon Valley, gibt es seit einiger Zeit Quelltextlesungen. Da treffen sich junge Coder wie Sebstian Sooth, Fiona Krakenbürger oder Kathrin Passig vor Publikum auf einer Bühne. Sie sprechen dann über Programmiersprachen, als handele es sich um Lyrik, analysieren Funktion und Aufbau wie Stil und Versmaß. Und weil auch im digitalen Zeitalter aus jeder Subkultur irgendwann einmal ein Kanon wird, ist es abzusehen, dass die Algorithmen unseren Alltag nicht nur wie mit unsichtbarer Hand bestimmen.
Noch ist die Debatte jung. Es sind ja auch keineswegs nur falsche Entscheidungen, die Algorithmen treffen, nicht nur sinistre Beweggründe in den Maschinen. Längst gibt es Forschungen, die humanistische Werte in den Algorithmen verankern. Am Imperial College in London arbeiten Informatiker und Philosophen beispielsweise gemeinsam an "Fair Play Algorithms". Das junge Feld der Roboter-Ethik sucht Wege, Menschenrechte in Code zu übersetzen.
Das Feuilleton des Süddeutschen Zeitung wird sich in den kommenden Wochen und Monaten verstärkt mit dieser neuen Weltsprache befassen. In der kommenden Wochenendausgabe wird Johannes Boie beschreiben, wie er Amerika als ein Land erlebt hat, das jetzt schon von Algorithmen geprägt ist. Eine Woche später soll ein Schwerpunkt die Dialekte der neuen Weltsprache, also die verschiedenen Codes betrachten. Es wird nur ein Anfang sein. Denn die Welt ist auch im Digitalen groß.