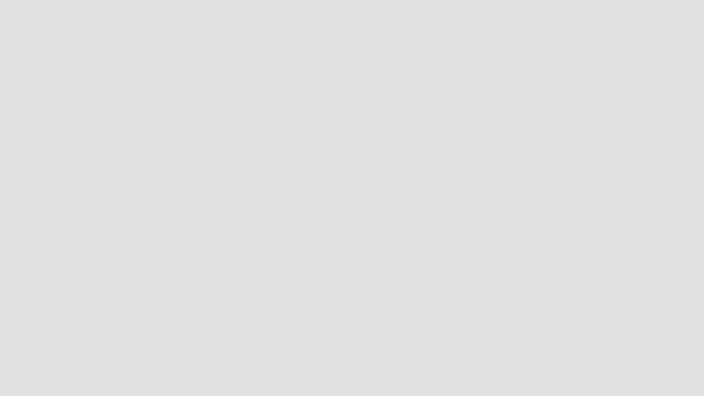Kurz vor 13 Uhr ist es still geworden auf den Fluren, das Durcheinander der Stimmen ist nur noch gedämpft zu hören. Vor wenigen Wochen erst hat das Wintersemester begonnen, für die Erstsemester steht der Präparierkurs auf dem Stundenplan. Ihre Rucksäcke haben sie in den unzähligen Spinden verstaut, die weißen Kittel übergestreift. So machen sich die Medizinstudenten in der Anatomischen Anstalt der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität ans Werk: Hinter den schweren Türen arbeiten sie sich mit Skalpell und Schere durch Hautoberfläche, Muskelfasern und Organe der konservierten Körper.
Medizin gilt nach wie vor als eines der beliebtesten Studienfächer, gemessen an der Zahl der Bewerber pro Studienplatz. Für das aktuelle Semester haben sich 43 000 Schulabgänger beworben, zusammen konnten die 35 Universitäten, an denen man in Deutschland das Fach Humanmedizin studieren kann, aber nur knapp 9100 Plätze vergeben - das macht ein Verhältnis von etwa fünf zu eins. Doch obwohl die medizinische Versorgung in Deutschland im internationalen Vergleich sehr gut abschneidet, regt sich Kritik daran, wie die Hochschulen die Ärzte von morgen auswählen und ausbilden. Viele in der Politik schreiben den gefürchteten Ärztemangel auf dem Land zum Teil auch den Universitäten zu - denn von den Studenten, die es bis zur Approbation schaffen, entscheiden sich im Mittel nur etwa zehn Prozent dafür, als Hausarzt zu arbeiten.
Um das zu ändern, erarbeitet die Bundesregierung derzeit den "Masterplan Medizinstudium 2020". Vertreter des Gesundheits- und des Bildungsministeriums beraten seit dem Frühjahr zusammen mit Verbänden und Gewerkschaften, wie die Universitäten die Allgemeinmedizin stärken können. Erste Ergebnisse sollen im kommenden Jahr vorliegen.
"Studenten nicht schon früh in ihren Möglichkeiten einschränken"
An Reformvorschlägen mangelt es derzeit nicht. In der Unionsfraktion im Bundestag kann man sich zum Beispiel vorstellen, einen Teil der Studienplätze für Bewerber vorzuhalten, die sich für eine spätere Tätigkeit als Landarzt verpflichten - zumindest "für eine bestimmte Zeit", wie die Hochschulpolitikerin Katrin Albsteiger (CSU) sagt. Medizinstudenten halten davon jedoch herzlich wenig. "Das Auswahlverfahren bei der Zulassung soll den späteren Erfolg im Studium sicherstellen und die Studenten nicht schon früh in ihren Möglichkeiten einschränken", sagt Raffael Konietzko, der bei der Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland für Ausbildungsfragen zuständig ist.
Ohnehin wird die Frage, mit welchem Verfahren die geeignetsten Bewerber für das Medizinstudium ausgewählt werden können, kontrovers diskutiert. Wer sich auf einen Studienplatz in Humanmedizin bewirbt, muss ein recht kompliziertes Verfahren bei der Stiftung für Hochschulzulassung, der Nachfolgerin der früheren Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen (ZVS), durchlaufen: Derzeit werden 20 Prozent aller Studienplätze allein nach der Abiturnote vergeben, weitere 20 Prozent nach der Wartezeit und 60 Prozent der Plätze können die Hochschulen nach eigenen Kriterien vergeben - wobei auch dort die Abiturnote neben der Ortspräferenz von besonderer Bedeutung ist.
Studienbewerber müssen daher nicht selten taktieren - wer sich zum Beispiel nur an besonders beliebten Universitäten um einen Platz bewirbt, "kann trotz eines Superabiturs Pech haben", gibt die Stiftung für Hochschulzulassung künftigen Bewerbern zu bedenken. Die hohe Bedeutung der Abiturnote wird schon lange kritisch gesehen. "Allein die Tatsache, dass jemand ein 1,0-Abitur hat, sagt an sich natürlich noch nichts darüber aus, ob er oder sie später ein guter Arzt wird", ist Ulrich Weigeldt, Bundesvorsitzender des Deutschen Hausärzteverbands, überzeugt.
Offen ist, welche Kriterien statt der Abiturnote aussagekräftig sein könnten - an viele Universitäten gibt es sogenannte Studierfähigkeitstests, die jedoch meist unterschiedlich ausgestaltet sind. "Es ist schwer zu messen, was einen guten Arzt ausmacht", sagt Raffael Konietzko von der BVMD. Dies gelte vor allem vor Aufnahme des Studiums - schließlich entwickelten sich erfolgreiche Studenten vom ersten Semester bis zur Approbation stetig weiter. Der Verband ist daher dafür, die aktuellen Quoten für Abiturnote und Wartezeit abzuschaffen und stattdessen ein einheitliches Verfahren bei der Zulassung zu erarbeiten. Das sei "fairer und transparenter" als das gegenwärtige, so Konietzko.
Zahl der Landärzte soll nicht künstlich erhöht werden
Unter Medizinstudenten gehen die Meinungen in der Frage, wie wichtig die Abiturnote sein soll, indes weit auseinander. In einer Befragung der Ärztegewerkschaft Hartmannbund sagten unlängst 48 Prozent der Studenten, dass die Note auch weiterhin eine zentrale Rolle im Zulassungsverfahren haben soll, 45 Prozent sahen das jedoch anders. "Bewährt" hat sich das bisherige System hingegen nach Ansicht des Medizinischen Fakultätentags, jedenfalls in seinen Grundzügen. Allenfalls ist der Verband dafür, die Wartezeitquote abzusenken, da dort der Studienerfolg "nachweislich geringer" sei als bei jenen Studenten, die über die Abiturquote oder die Zulassungsverfahren der Universitäten einen Platz erhalten haben. Ohnehin halten es die deutschen Unikliniken sowie die medizinischen Fakultäten laut einer gemeinsamen Stellungnahme für "nicht zielführend", die Zahl der Landärzte durch Eingriffe in die Zulassungsverfahren erhöhen zu wollen. Es handele sich bei dem Landarztmangel um ein "Verteilungsproblem, das nur durch eine Steigerung der Attraktivität des Berufes" lösbar erscheint.
Ein zweiter Ansatz, um die Zahl der späteren Landärzte schon im Studium möglichst zu erhöhen, besteht in einer Aufwertung des Faches Allgemeinmedizin. Derzeit gibt es mehr als 30 Fachgebiete, von der Anästhesiologie bis zur Urologie, nicht alle werden an allen Universitäten gelehrt. Immer wieder berichten Medizinstudenten jedoch davon, dass gerade die Allgemeinmedizin von Vertretern anderer Fachteile als vergleichsweise öde und anspruchslos dargestellt werde: Hier die Chirurgen, die komplizierte Operationen durchführen, dort die Allgemeinmediziner, die höchstens mal eine Spritze setzen dürfen.
Doch es geht in der Frage nicht allein um das Image: "In der Vergangenheit spielte die Allgemeinmedizin an vielen medizinischen Fakultäten quasi keine Rolle, das hat sich in der Zwischenzeit auf jeden Fall schon deutlich verbessert", sagt Ulrich Weigeldt vom Hausärzteverband. "Trotzdem ist es immer noch ein untragbarer Zustand, dass die Allgemeinmedizin, als das wichtigste Fach der Primärversorgung, nicht an jeder medizinischen Fakultät mit einem eigenen Lehrstuhl vertreten ist."
Dass die Allgemeinmedizin vergleichsweise schwach vertreten ist, hat historische Gründe: Seitdem Medizin an Universitäten gelehrt wird, bestand der klassische Fächerkanon stets aus Anatomie, Chirurgie und Innerer Medizin. Vor allem die Anatomie, also die Lehre vom Aufbau des menschlichen Körpers, prägt das Bild von angehenden Ärzten bis heute - und dort insbesondere der Präparierkurs, der nicht nur an der LMU München zum Pflichtstoff für Erstsemester gehört.
Mehr Lehrstühle für Allgemeinmedizin gefordert
Gleichwohl ist die Forderung, mehr Lehrstühle für Allgemeinmedizin einzurichten, derzeit recht populär: Auch nach Ansicht der Bundesärztekammer kann die Allgemeinmedizin am ehesten aufgewertet werden, indem an jeder Universität mit einer medizinischen Fakultät ein eigener Lehrstuhl besteht. Am besten gleich zu Beginn sollten Studenten an das Fach beziehungsweise an die Tätigkeit als Hausarzt herangeführt werden, heißt es dort. Als etwa zu Beginn des vergangenen Jahres an der Universität Erlangen-Nürnberg der erste reguläre Lehrstuhl für Allgemeinmedizin in Bayern entstand, sprach sich auch die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) dafür aus, an jeder Universität eine entsprechende Professur zu schaffen. Seit wenigen Wochen gibt es im Freistaat nun einen zweiten Lehrstuhl: Mitte Juni wurde die seit 2009 an der Technischen Universität (TU) München bestehende Stiftungsprofessur in einen ordentlichen Lehrstuhl für Allgemeinmedizin umgewandelt.
Ob der Schritt - abseits aller Fragen der Finanzierung - letztlich auch dazu führt, dass Medizinstudenten nach dem Abschluss des Studiums eine entsprechende Berufsentscheidung treffen, ist indes völlig offen. Gleiches gilt für den Vorschlag, die Allgemeinmedizin zum Pflichtteil im Rahmen des Praktischen Jahrs (PJ), das am Ende der Ausbildung steht, zu machen. Derzeit besteht das PJ aus drei gleich großen Teilen, davon sind die Chirurgie sowie die Innere Medizin in der Regel Pflicht - der dritte Teil kann von den Studenten frei gewählt werden. Laut der Befragung des Hartmannbunds können sich derzeit nur etwas mehr als sechs Prozent aller Studenten vorstellen, ihren Wahlteil in der Allgemeinmedizin zu verbringen.
Den Vorschlag, das Fach zur Pflichtstation im PJ zu machen, sehen viele kritisch. "Eine höhere Affinität zu einem bestimmten Fachgebiet lässt sich nur über die Steigerung seiner Attraktivität erreichen", heißt es dazu bei der Ärztegewerkschaft Marburger Bund. Attraktivität, das heißt vor allem: Weniger Arbeitsbelastung und mehr Geld für Hausärzte - nichts also, worauf die Hochschulen Einfluss nehmen könnten.