Natürlich ist alles streng geheim. Niemand darf reden, und wer es doch tut, wird belangt, oder gefeuert. Kein Wunder, dass sich das wie ein Phantom durch die Medienlandschaft stromernde iCar von Apple hinter einer Mauer des Schweigens versteckt. Einer Firma, die selbst kleinste Details zu neuen Projekten unter Verschluss hält wie den Zugangscode zu Fort Knox, fallen auf die Frage nach einem projektierten Automobil nur zwei Worte ein: Kein Kommentar.
Doch je dürrer die Dementis, desto mehr Fragen werfen sie auf. Hat das überhaupt Sinn - ein iCar von Apple, ein Bubble Car von Google? Will sich ein Unternehmen, das an Margen von 30 Prozent und mehr gewöhnt ist, mit einer Nettorendite von drei oder fünf Prozent zufrieden geben? Und wer ist die Zielgruppe, wie hoch darf der Preis sein, wie sieht das anvisierte Eigenschaftsprofil aus, welche Kanäle werden Vertrieb und Wartung übernehmen? Und wie soll eine Firma, die außer dem Design so ziemlich jeden Handgriff nach draußen vergibt, ein extrem komplexes Produkt wie ein Auto ohne Partner in den Griff bekommen?
Es geht um die Anzahl der Klicks
Ähnliche Überlegungen haben auch die Chefs der deutschen Premiummarken angestellt. Die Herren Reithofer (BMW), Winterkorn (VW) und Zetsche (Daimler) sehen - so das ausnahmsweise einheitliche Credo - Apple und Google als Risiko, aber auch als Chance. Angst, so der Tenor, hat man keine, doch es gilt auf der Hut zu sein, denn der Kampf um die Vorherrschaft auf der Straße ist ein immer wichtigeres, rasch wachsendes und potenziell hoch profitables Geschäft.
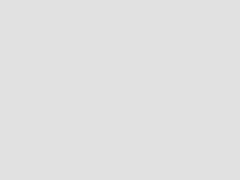
Vom Fahrzeugentwickler bis zum Batterie-Fachmann holt sich Apple offenbar immer mehr Autoexperten ins Haus. Nun wird der IT-Konzern deshalb verklagt.
Dabei geht es nicht in erster Linie um Bedienoberflächen, Endgeräte, das ewige Duell zwischen Android und iPhone oder die stabilste Internetverbindung. Nein, was das Geschäft entscheiden wird, ist die Anzahl der Klicks, mit denen sich der User im Netz die Zeit vertreibt, während er zwischen Wohnung und Arbeit hin- und herpendelt.
Der Kampf hat längst begonnen
Damit dabei nicht die Windschutzscheibe sondern der Bildschirm im Fokus des Fahrers steht, muss sich das Automobil weitgehend autonom bewegen. Obwohl wir diesen Zustand möglicherweise nicht vor 2025 erreichen werden, hat der Kampf um die Aufmerksamkeit (und das Konto) der Automobilisten längst begonnen. Da werden wie im Netz auch im Auto ganz bestimmte Hotels und Gaststätten vorgeschlagen, nur ausgewählte Tankstellen angezeigt, ungefragt mehr oder weniger offene Werbung geschaltet. Es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis das zunehmend korrupte Infotainment den Ampelstopp neben dem Supermarkt zur Auflistung der aktuellen Sonderangebote missbraucht.
Klar, dass die Autoindustrie diesem Treiben nicht tatenlos zusehen und sich in die Rolle des passiven Hardware-Providers drängen lassen will. Zu gefährlich ist Google, der allwissende Riese, der mit immer neuen Inhalten auftrumpft. Zu gefährlich ist Apple, das mit der Strahlkraft seiner Marke (vom Cashflow ganz zu schweigen) selbst große Namen in den Schatten stellt. Wenn die IT-Fraktion sich durchsetzt und auf den wesentlichen Ebenen die Mobilitätssystemführerschaft für sich reklamieren kann, dann bleibt für Audi, BMW und Mercedes in letzter Konsequenz nur die Spaß- und Prestigeauto-Nische - viel zu wenig, um sich dauerhaft zu refinanzieren.
Apple hat schon vor zwei oder drei Jahren seine Fühler zunächst in Richtung Detroit ausgestreckt, ist bei den Lowtech-Anbietern aber nur bedingt fündig geworden. Auch in Europa sind die Kalifornier seit geraumer Zeit in Sachen iCar unterwegs; zuletzt hat man im Februar kurz vor dem Genfer Salon die Runde gemacht.
Es gibt natürlich keine offizielle Bestätigung, aber nach Aussage mehrerer Quellen fühlt sich der IT-Gigant bei BMW besonders gut aufgehoben. Demnach hat es den Amerikanern vor allem der i3 angetan, der als reines E-Mobil und mit Range Extender angeboten wird. Vergangenen Herbst reiste der komplette BMW-Vorstand nach Cupertino, Anfang 2015 gab's den Gegenbesuch in München.
Gegenseitiger Lernprozess
Doch wer glaubt, dass Apple jetzt in China nach iPhone-Muster eine Großserienfertigung des i3 aus dem Boden stampfen wird, der dürfte sich irren. Was die Beziehung zwischen den zwei starken Marken bislang beherrscht, ist vielmehr ein gegenseitiger Lernprozess. BMW hat verstanden, dass Software-Entwickler auch in der Autowelt immer öfter die Schlagzahl vorgeben, indem sie zum Beispiel das autonome Fahren vorantreiben. Apple hat verstanden, dass man ein Auto nicht im Minutentakt zusammennageln kann wie ein Handy. Mehr noch: In Cupertino weiß man jetzt, dass Kerneigenschaften wie Fahrdynamik, Sicherheit und Effizienz das Resultat langjähriger Erfahrung sind. Probleme gibt es noch mit der Anpassung der stark unterschiedlichen Tempi, die beide Branchen in Sachen Forschung und Entwicklung an den Tag legen.

Die Autoindustrie arbeitet mit Vollgas an ihrer Zukunft: In Kalifornien können nun selbstfahrende Autos auf öffentlichen Straßen getestet werden. Doch die neue Ära des Fahrens wirft ein ethisches Dilemma auf.
Noch ist nichts in trockenen Tüchern, aber es gibt zumindest erste Trends. Apple wird sich ab sofort noch stärker einbringen ins Automobilgeschäft. Und zwar mit klassischen Stärken wie Design, Materialität, Bedienoberflächen, Vernetzung und in letzter Konsequenz kompletten Cockpitmodulen. Was die IT-Giganten (noch) nicht können, ist Karosserie, Fahrwerk, Antrieb, Sicherheit, Prozesse, Vertrieb.
BMW-Chef Reithofer sieht auch deshalb Apple eher als Chance denn als Gefahr. Erstere besteht darin, als erster die besten Systeme in seinen Fahrzeugen anbieten zu können und damit Technologieführerschaft zu beweisen. Das Risiko besteht darin, dass Apple als Marke die Marke BMW aussticht, was Gift wäre für eine paritätische Partnerschaft.
Es ist nicht davon auszugehen, dass Apple ohne entsprechendes Know-how in Eigenregie Elektroautos baut. Fast genauso unwahrscheinlich ist es freilich, dass Apple den aktuellen i3 übernimmt und im Handstreich über Nacht zum iCar umfunktioniert. Der Grund: der i3 ist in der Herstellung viel zu teuer, die Stückzahlen (2014 rund 16 000 Einheiten statt 25 000 wie geplant) sind selbst für einen Newcomer viel zu gering, die Technik bekommt schon sehr bald ein Update, das sich leider nicht kostenlos von der Cloud herunterladen lässt.
Derzeit werden dem Vernehmen nach zwei Szenarien durchgespielt. Plan A erinnert an das Bubble Car von Google, denn hier handelt es sich um einen Cityflitzer, der maximal 100 km/h schnell sein soll. Die Strategie: rund 70 Prozent der Gesamtfahrleistung konzentriert sich auf dicht besiedelte Gebiete, wo ein Auto nicht alles können muss und die Grundfunktionen entsprechend leichter beherrschbar sein dürften. Doch dieser Ansatz erfüllt nur ganz bedingt den hohen Anspruch, den Apple an seine anderen Produkte stellt und der die Marke so stark gemacht hat. Außerdem ist BMW wohl kaum für ein derartiges Minimal-Mobil zu begeistern.
Deshalb könnte am Ende Plan B zum Einsatz kommen, der schon 2018 erste Früchte tragen soll. Hier geht es zwar auch um den i3 - aber eben nicht um das Auto, das wir kennen. Stattdessen wird über eine runderneuerte Evolutionsstufe nachgedacht, die neben mehr Leistung und mehr Reichweite auch einen geradezu dramatischen Kostenvorteil in Aussicht stellt. Hinter vorgehaltener Hand wird kolportiert, dass ein komplett geänderter Materialmix und ein deutlich ambitionierteres Stückzahlgerüst den Produktionsaufwand glatt halbieren würden.

Die Vorbehalte gegen Elektroautos sind groß. Der Alltagstest des BMW i3 und Toyota Prius Plug-in-Hybrid zeigt, dass es auch ohne Sprit geht. Allerdings müssen die Voraussetzungen stimmen, sonst überlagert Reichweitenangst den Fahrspaß.
Tun sich Apple, BMW und Magna zusammen?
An dieser Stelle kommt Magna ins Spiel. Die Österreicher sind bewährte Karosseriebauer und routinierte Auftragsfertiger, doch ihre Gesamtfahrzeugkompetenz gilt nicht als überdurchschnittlich hoch. Für Magna spricht vor allem die Nähe zu BMW - in technischer, unternehmerischer und geografischer Hinsicht.
Um den i3 für eine konventionelle Fertigungsstraße fit zu machen, müsste die Karbon-Architektur durch eine aus mehreren Werkstoffen modular aufgebaute Matrix ersetzt werden. Das klingt nach Denkmalsturz, wäre aber genau das, was BMW spätestens im übernächsten Schritt ohnehin vorhat. Karbon ist nämlich nicht nur zu teuer und in der Verarbeitung schwer beherrschbar, es ist auch eher Imagetreiber als Königsweg. Der Wechsel zum flexiblen Materialmix stellt eine Jahresstückzahl von 200 000 Einheiten in Aussicht.
Damit könnte für den Anfang vermutlich sogar Apple leben - sei es in Form eines weitgehend eigenständigen iCar engineered by BMW oder als evolutionär gestalteter i3 mit Apple innen drin. Es wird also entscheidend sein, wo genau die Trennlinie zwischen Kooperation und Konfrontation gezogen wird.
Wenn sich Apple, BMW und Magna tatsächlich zusammentun, dann entsteht eine Allianz, die andere Hersteller in Zugzwang bringt. Warum? Weil sich BMW vom Know-how-Transfer natürlich einen Wettbewerbsvorsprung verspricht, von dem in skalierter Form zeitnah alle Baureihen profitieren würden. Das hört sich gut an - und schießt in gewisser Weise trotzdem am Ziel vorbei. Denn was die Branche wirklich braucht, ist einen über Bluetooth hinaus normierten IT-Standard, der stringent genug ist, um Kosten zu sparen und flexibel genug, um die unterschiedlichen Markenwelten abzubilden. Weil es fatal wäre, wenn jeder Hersteller seine eigenen Schnittstellen hegt und pflegt, betrifft diese Standardisierung die komplette Software und Hardware-Applikation.
