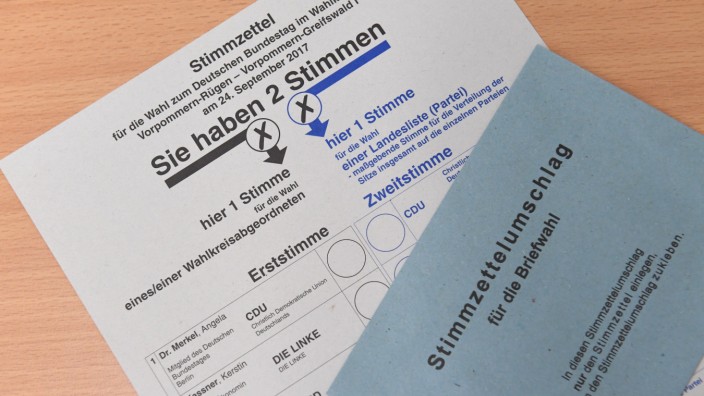Hier eine gute Nachricht für die Bewohner von Utting am Ammersee - jedenfalls für manche von ihnen: Nach der Wahl am 24. September sind sie ganz sicher ihren Bundestagsabgeordneten los. Dabei geht es um keinen Hinterbänkler: Bislang war es Alexander Dobrindt (CSU), vier Jahre lang Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur und damit zuständig für Pkw-Maut und Diesel-Skandal. Das heißt nicht, dass Dobrindt aus dem Parlament fliegt, denn er tritt in seinem Wahlkreis wieder an - und dass ein CSU-Kandidat in Oberbayern ein Direktmandat verliert, das ist doch unwahrscheinlich. Nur gehört Utting nicht mehr zu Dobrindts Wahlkreis Weilheim, sondern zum Wahlkreis Starnberg-Landsberg am Lech. So hat es der Bundestag im Mai 2016 beschlossen, als er die Neuwahl des Parlaments vorbereitete.
Solche Veränderungen sind nötig, damit jede Stimme ungefähr gleich viel zählt, auch wenn Bürger zwischen den Abstimmungen zu- oder wegziehen, volljährig werden oder sterben. Für diese Bundestagswahl sind die Grenzen von 34 Wahlkreisen neu gezogen worden. Mal ging es nur um einen Stadtteil wie Eilbek in Hamburg, der vom Wahlkreis Hamburg-Mitte nach Hamburg-Wandsbek wanderte, mal um ein ganzes Direktmandat: Thüringen hat im Vergleich zu 2013 einen Wahlkreis verloren, Bayern einen gewonnen. In beiden Ländern sind darum jeweils sechs Gebiete neu abgesteckt worden.
Eine Erststimme hat im kleinen Coburg viel mehr Einfluss als im großen Wahlkreis Fürth
Hätte man Peter Gritzmann um Rat gefragt, hätten die Uttinger ihren Dobrindt vermutlich auch eingebüßt. Nur kam der Mathematiker von der Technischen Universität München mit zwei Kollegen zu diesem Resultat nicht über das übliche politische Verfahren, samt Tagungen der Wahlkreiskommission, Voten von Kreistagen, Landesregierungen und Parteien sowie einer Abstimmung im Bundestag und einer Anlage zum Bundeswahlgesetz. Stattdessen: Formeln, numerische Optimierungsverfahren, Computerprogramme.
"Mit unserem Verfahren ist es möglich, die für die Demokratie so wichtige Aufteilung des Staatsgebiets in Wahlkreise gleicher Größe jeglichem Einfluss von Menschen zu entziehen, die damit vielleicht ihre eigenen Interessen verbinden", sagt Gritzmann. Er beeilt sich aber hinzuzufügen: "Wir sagen nicht, so muss man es machen, sonst ist es falsch. Wir sagen, so kann man es machen, wenn man bessere Ergebnisse haben möchte."
Besser, das heißt in diesem Fall näher an den Forderungen des Wahlgesetzes. Es sieht vor, dass in allen Wahlkreisen die gleiche Anzahl von deutschen Staatsbürgern lebt. Die tatsächliche Zahl darf von der durchschnittlichen Größe der 299 Wahlkreise (etwa 246 000 Einwohner) nur um 25 Prozent abweichen - sonst müssen die Grenzen neu gezogen werden. Dabei dürfen die Grenzen der Bundesländer nicht geschnitten werden. Auch Kreis- und erst recht Gemeindegrenzen sollen möglichst beachtet werden, was nicht immer gelingt.
Das Gesetz gibt außerdem vor, dass die Behörden schon Abweichungen von mehr als 15 Prozent vermeiden sollen. Das klappt diesmal bei einem guten Fünftel der Wahlkreise nicht. In Fürth, Paderborn und Bremen leben jeweils sogar mehr als 23 Prozent Menschen zu viel in den Bezirken, das oberfränkische Coburg ist um eine ähnliche Quote zu klein. Für die Zweitstimme macht das keinen Unterschied, aber es bedeutet, dass eine Erststimme in Coburg viel mehr Einfluss auf die Wahl des Direktkandidaten hat als etwa in Fürth. Bundesweit beträgt die Abweichung im Mittel knapp zehn Prozent. Das ginge auch anders: Gritzmann könnte diesen Wert mit seinem Verfahren deutlich unter drei Prozent senken (European Journal of Operational Research).
Die Methode ist kompliziert und mathematisch anspruchsvoll. Teilweise brauchte der PC des TUM-Forschers einige Stunden für die Lösung. Man gibt dabei eine ungefähre Einwohnerzahl vor, die alle Wahlkreise haben sollen, und lässt dann den Computer eine Region rund um das bisherige Wahlkreis-Zentrum suchen, die das erfüllt - und auch noch möglichst handlich ist. Das Prinzip dahinter ist einfach, sagt der Mathematiker: "Es geht eigentlich darum, die Distanz zum Zentrum des Wahlkreises für alle Gemeinden darin zu optimieren."
In den USA wissen Parteien genau, welcher Zuschnitt der Wahlkreise für sie hilfreich ist
Nur dass "Distanz" für Mathematiker vieles bedeuten kann. Drei verschiedene Verfahren führen die Wissenschaftler als Beispiele für ihre Methode an: Das erste sucht nach Gemeinde-Kombinationen, bei denen die Luftlinie vom Rand des Wahlkreises zum Zentrum möglichst gering ist. Das produziert relativ kompakte, rundliche Wahlkreise, aber berücksichtigt nicht die Geografie: Es kann zum Beispiel passieren, dass ein Wahlkreis von einem See oder dem Zipfel eines anderen Bundeslandes zerschnitten wird, das erlaubt das Gesetz eigentlich nicht. Das zweite Verfahren arbeitet statt mit der Luftlinie mit Straßenverbindungen, so dass die Fahrtstrecken im Wahlkreis möglichst kurz sind. Das hat den Vorteil, dass die entstehenden Gebiete immer zusammenhängen, auch wenn sie meist etwas länglich ausfallen.
Das dritte schließlich sprengt das Alltagsverständnis, weil die Forscher dafür sozusagen den Raum verformen: Sie wählen für jeden Wahlkreis eine Ellipse, die dessen bisheriger Form möglichst nahe kommt, und suchen dann nach einem neuen Zuschnitt mit besser passender Einwohnerzahl, der sich statt an der physischen Distanz zum Zentrum an der Ellipse orientiert. Der Vorteil bei diesem komplizierten Verfahren ist, dass es mit einer Information über den bisherigen Wahlkreis startet.
Für alle drei Verfahren gilt: "Nach dieser Aufteilung anhand der Gemeinden war die Zahl der Wähler in den neuen Wahlkreisen bereits fast so ausgeglichen wie theoretisch möglich", sagt Gritzmann. "Könnten wir das Verfahren mit den Daten der einzelnen Wahllokale wiederholen, wäre das Ergebnis noch besser." Allerdings bleiben strukturelle Probleme, die das Verfahren nicht beheben kann. Mecklenburg-Vorpommern etwa hat zu viele Wähler für seine sechs Wahlkreise, aber für einen siebten sind es zu wenig. Da das Verfahren, wie im Gesetz vorgesehen, nur innerhalb der Landesgrenzen optimiert werden darf, ließ sich die Abweichung im Durchschnitt nicht unter 8,7 Prozent senken.
Dass Gritzmanns Methode demnächst von den Behörden aufgegriffen wird, ist nicht realistisch. Häufig passt es schlecht zu den politischen Strukturen, zum Beispiel, weil sich die Parteien oft in Landkreisen organisieren, so dass Politiker diese ungern auf verschiedene Wahlkreise aufteilen, auch wenn das mathematisch sinnvoll wäre. Das aufzugeben, um die Anforderungen von Gesetz und Gerichten an die Wahlkreis-Aufteilung zu überbieten, dürfte auf Widerstand stoßen.
Noch größer wäre dieser aber wohl in jenen Staaten, wo Wahlkreisgrenzen massiven politischen Einflüssen ausgesetzt sind - dort also, wo ein neutrales mathematisches Verfahren tatsächlich der Demokratie dienen würde. In Ländern mit reinem Mehrheitswahlrecht wie Großbritannien, Frankreich oder den USA wissen die Parteien oft sehr genau, welche Gebiete ihnen aufgrund ihrer sozialen Struktur oder Tradition zuverlässige Mehrheiten liefern. Mit dieser Kenntnis Wahlkreise maßzuschneidern, um sich einen Vorteil zu verschaffen, nennt man "Gerrymandering". Der Ausdruck geht auf Massachusetts' Gouverneur Elbridge Gerry zurück, der Anfang des 19. Jahrhunderts die Wahlkreise in seinem Staat zum eigenen Nutzen manipulierte. Weil ein Bezirk an die Form eines Salamanders erinnerte, schrieb die Boston Gazette im März 1812 vom "Gerry-mander".
In den USA haben sich vor allem die Republikaner mit diesem Trick über die Jahre Vorteile verschafft. So sagen Umfragen zurzeit vorher, dass bei den Midterm-Wahlen zum Repräsentantenhaus im Jahr 2018 gut 54 Prozent der Wähler für demokratische Kandidaten stimmen. Eine Auswertung der Organisation Decision Desk zeigt jedoch, dass die Oppositionspartei damit nur 47 Prozent der Mandate gewinnen würde.
Diese mögliche Folge des Mehrheitswahlrechts ist im deutschen System mit seiner Zweitstimme allerdings kaum eine Gefahr. "Für Parteien in Deutschland sollte Gerrymandering ziemlich uninteressant sein, da sie keinen Vorteil durch den Wahlkreisgewinn haben, wenn für jedes gewonnene Direktmandat ein Listenmandat gestrichen wird", bestätigt Martin Fehndrich von der Organisation Wahlrecht.de. Auch Überhangmandate nützen niemandem mehr, weil es seit der Bundestagswahl 2013 Ausgleichsmandate gibt.
Allerdings kann sich im Einzelfall schon etwas ändern. Der Bundeswahlleiter in Wiesbaden hat sich die Mühe gemacht, die Stimmen von 2013 so umzurechnen, als wären sie schon damals in den neuen Bezirken abgegeben worden. Dabei gab es eine Überraschung: Im Wahlkreis Potsdam-Mittelmark II hat 2013 die CDU-Abgeordnete Katherina Reiche das Direktmandat errungen, mit 730 Stimmen Vorsprung vor Andrea Wicklein von der SPD. Wäre der Wahlkreis damals so zugeschnitten gewesen wie heute, hätte Wicklein 192 Stimmen Vorsprung gehabt. Für sie war es egal, weil sie auf der Landesliste abgesichert war. Reiche aber wäre nicht in den Bundestag gekommen, weil ihre Partei in Brandenburg nach dem Gewinn fast aller Direktmandate niemanden von der Landesliste ins Parlament schicken konnte. Nach der Wahl war sie übrigens zwei Jahre lang parlamentarische Staatssekretärin - im Verkehrsministerium unter Alexander Dobrindt.