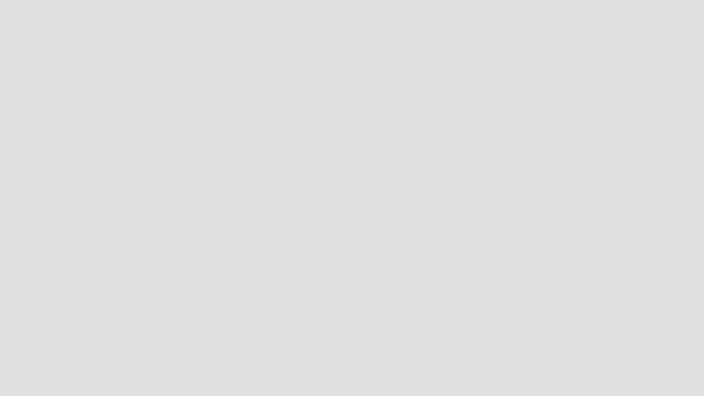Martin Hellwig wohnt in Bonn. Er schaut oft auf den schönen Rhein und sieht die Containerschiffe vorüberziehen. Doch Hellwig sieht hier nicht nur die Idylle. Er sieht auch einen Wirtschaftskrimi, der den deutschen Steuerzahler noch Milliarden Euro kosten wird. Es geht in dieser Geschichte um das Geschäft der Reeder und um staatliche Banken. Am Ende geht es wohl um einen der teuersten Skandale der Zeit. Erst diese Woche musste die NordLB einen Verlust in Höhe von fast zwei Milliarden Euro verkünden. Dieses Institut ist die größte Landesbank im Norden der Republik, gehört also den Steuerzahlern.
Containerschiffe sind eine tolle Sache. Sie bringen die neueste Playstation aus Asien und Avocados aus Mexiko nach Deutschland. Manche sagen: Nur dank Containerschiffen gibt es überhaupt die Globalisierung, gibt es internationale Handelsrouten rund um den Globus, von denen gerade das handelsstarke Deutschland so profitiert. Wie wichtig die Containerschiffer sind, merkten einige im vergangenen Herbst. Eine große südkoreanische Reederei ging plötzlich pleite. Schiffe hingen auf dem Meer fest - und damit auch die vielen Dinge, die Menschen in Deutschland bestellt hatten. Ohne Containerschiffe sitzen viele auf dem Trockenen. Aber derzeit sind es vor allem die Reeder selbst, denen es schlecht geht. Mit drastischen Folgen.
Banken schenken ihren Kunden selten etwas. Bernd Kortüm bekam gleich mehr als eine halbe Milliarde Euro. Ihm wurden Schulden in Höhe von 547 Millionen Euro erlassen, von der HSH Nordbank. Auch das ist ein staatliches Institut. Es hat sich so sehr mit Schiffskrediten verzockt, dass es nun privatisiert werden muss. Angeblich sind Investoren aus China und den USA interessiert, aber noch ist alles offen. Bernd Kortüm und die HSH sind eng verbunden. 2008 betrug seine Kreditlinie bei der Bank zwei Milliarden Euro. Das war der Grund, warum sich die HSH zu diesem beachtlichen Schuldenschnitt entschloss. Eine Pleite hätte das Institut wohl noch weitaus mehr Geld gekostet.
Kortüm führt die Norddeutsche Reederei H. Schuldt. Sie residiert mitten in der Hamburger Innenstadt in einem Konstrukt aus Glas und Stahl, das ungefähr so charmant ist wie ein Autohaus. Schaukästen im Erdgeschoss zeigen Modelle von mächtigen Frachtschiffen. "Northern Glory" steht auf einem. Sehr ruhmreich hat sich Kortüm nicht benommen, sagen seine Kritiker. Ungefähr zur gleichen Zeit, als die HSH dem Reeder Kortüm eine halbe Milliarde Euro erließ, kaufte sich der Privatmann Kortüm eine neue Segelyacht. Kolportierte Kosten laut Makler: knapp neun Millionen Euro. Als er damals gefragt wurde, ob das nicht unanständig sei, argumentierte Kortüm, es handle sich ja um ein 14 Jahre altes Boot, für das er "deutlich weniger als die Hälfte" des genannten Kaufpreises gezahlt habe. Es sei "ein absolutes Schnäppchen" gewesen.
Die Verbindungen zwischen Politik und Schifffahrt waren im Norden stets innig, es schien ein gutes Geschäft für beide Seiten zu sein. Doch seit sich abzeichnet, wie teuer es für die Steuerzahler noch werden könnte, ist der Tonfall ein anderer. Die Hamburger Senatskanzlei nannte das Verhalten bestimmter Kreditnehmer auf einmal "unsensibel und empörend". Die Kanzlerin ließ wissen, sie fände es gut, wenn die Reeder ihre Schiffe wieder öfter unter deutscher Flagge fahren ließen, man sei ihnen schließlich schon genug entgegengekommen. Und beim gesetzten Abendessen in der ehrwürdigen Hamburger Handelskammer mussten die Reeder hinnehmen, dass ihnen Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Torsten Albig eine Moralpredigt hielt, als wären sie eine Horde ungezogener Schuljungen mit Smoking.
Einst bewundert, nun beschimpft - wie konnte es nur so weit kommen? Martin Hellwig, der Mann vom Rhein, beobachtet die Reeder und ihre Banken seit langem. Hellwig arbeitet am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern und beschäftigt sich viel mit Banken. In der Finanzkrise saß er in einem Ausschuss, der den Staat beriet, als dieser Notkredite an deutsche Unternehmen vergab. Auch Hapag-Lloyd beantragte damals Staatshilfe.
Darum müssen Reeder ums Überleben kämpfen
Hellwig kann die ökonomische Logik hinter der lebensbedrohlichen Krise der Branche erklären. Es gibt viele verschiedene Anbieter, die mit aller Härte um Marktanteile kämpfen. Laut Daten des Branchendiensts Alphaliner hat der Marktführer Maersk nur einen Anteil von derzeit rund 16 Prozent. Auf Platz zwei folgt MSC mit 15 Prozent. Der deutsche Anbieter Hapag-Lloyd landet mit fünf Prozent nur auf Platz sechs. Dazu kommen elf Anbieter mit einem Marktanteil von ein bis drei Prozent. Ökonomen sprechen von einem stark zersplitterten Markt. Es gibt keinen Anbieter, der so mächtig ist, dass er die Preise diktieren kann. Für die Wettbewerbsbehörden beginne Marktbeherrschung bei 33 bis 40 Prozent Marktanteil für eine Firma, sagt Hellwig. "Davon sind wir weit entfernt." Deswegen sind die Preise relativ niedrig - für manche zu niedrig, wie die Pleite der Reederei aus Südkorea gezeigt hat.
Und noch etwas verschärft den Wettbewerb: In der globalisierten Welt müssen Güter zwar von China nach Europa gefahren werden. Aber ob Firma A oder Firma B das übernimmt, macht kaum einen Unterschied. Hauptsache, die Ware kommt rechtzeitig an. Das leisten alle Anbieter mehr oder weniger gleich gut. Außerdem können die Reeder nicht einfach ihre variablen Kosten verringern, wenn die Nachfrage einbricht. Ein Schiff nur halb voll über den Atlantik fahren zu lassen, kostet fast genau so viel, wie ein volles Schiff loszuschicken. Das ist die vertrackte Lage.
Vor der Finanzkrise wurden immer mehr Schiffe neu geordert, und zwar auf viele Jahre im Voraus. Alle dachten, der Boom der Globalisierung werde wie in den Neunziger- und Nullerjahren weitergehen. Nach der Finanzkrise aber brach der Welthandel ein. Jetzt gab es viel zu viele Schiffe. Und Jahr für Jahr wurden noch mehr fertiggestellt. Ökonomen sprechen von wachsenden Überkapazitäten. Sie lassen die Preise weiter abstürzen. Man könnte auch sagen: ein Teufelskreis.
Die HSH Nordbank stieg auf zum weltgrößten Schiffsfinanzierer
Angeheizt hatte den auch die Finanzindustrie. Bevor die Blase platzte, galten Schiffe bei Gutverdienern als empfehlenswerte Anlage. Seit den Siebzigerjahren haben deutsche Sparer mehrere Milliarden in die Finanzierung von Schiffen gesteckt. Damit ermöglichten sie der deutschen maritimen Wirtschaft einen beispiellosen Aufstieg zu einer der größten Schifffahrtsnationen. Über Schiffsfonds sammelte die Branche das Eigenkapital für den Erwerb eines Schiffes, in der Regel 40 Prozent. Der Rest kam über eine Schiffshypothek von einer Bank. Solange der Welthandel Jahr für Jahr wuchs, funktionierte das Modell. Die Anleger freuten sich über zweistellige Renditen, noch mehr freuten sich die Fondsverkäufer über die Provisionen. Die HSH Nordbank stieg auf zum weltgrößten Schiffsfinanzierer, wurde bekannt von den USA bis nach Südkorea.
Der Fall HSH wird für den Steuerzahler teuer, so viel steht fest. Ökonom Hellwig schätzt die Verluste und Risiken für den Steuerzahler auf rund 17 Milliarden Euro. Und es könnte durch die Privatisierung der Bank noch mehr werden, wenn der Investor das heraushandelt. "Bei einem Landeshaushalt von elf Milliarden Euro in Schleswig-Holstein ist das kein Pappenstiel", sagt Hellwig.
Der Aufstieg der deutschen Reeder und Schiffsbanken konnte nur mithilfe der Politik funktionieren. Ein Argument dafür lautet bis heute: Die Exportnation Deutschland braucht eben eine eigene Schiffsindustrie, deshalb muss der Staat etwas springen lassen. Und da geht es nicht nur um Milliarden von Staatsbanken. Auch bei der Lohn- und Einkommensteuer profitieren die Reeder. Der Staat subventioniert sie. Ihre Gewinne werden nur pauschal ermittelt, zur "Sicherung des Reedereistandortes Deutschland". Der Gewinn der Handelsschiffe wird anhand der Tonnage geschätzt, damit reduzieren sich Gewerbe-, Einkommen- und Lohnsteuer. "Dies dient der Wettbewerbsgleichheit deutscher Reeder im internationalen Vergleich", heißt es im Subventionsbericht der Bundesregierung. Außerdem ziehen die Reeder wie alle Arbeitgeber die Lohnsteuer bei ihren Seeleuten ein - dürfen dieses Geld aber teilweise behalten, statt es ans Finanzamt zu überweisen.
"Dahinter steckt noch die Flottenromantik vergangener Zeiten"
Hellwig will diese Gründe nicht gelten lassen. Die deutsche Exportwirtschaft könne einfach die Schifffahrten buchen, die sie brauche. "In einem durch Wettbewerb geprägten Markt ist das unproblematisch", sagt er. Die Subventionierung bringe kaum Vorteile. "Die Situation in den Märkten für Schiffstransporte wird dadurch nicht wesentlich verändert, dazu ist die deutsche Seeschifffahrt viel zu klein." Die Gefahr, dass eines Tages etwa die chinesischen Anbieter zu mächtig werden und den Markt kontrollieren können, sieht er nicht. Auch das Standort-Argument lehnt er ab. "Dahinter steckt noch die Flottenromantik vergangener Zeiten", sagt er.
Die einst führende Rolle bei der Schiffsfinanzierung hat Deutschland verloren. Neue Frachter werden jetzt häufiger in Südkorea und China finanziert und gebaut. Hype und Hybris waren groß in Deutschland. Der Schaden ist es auch.