Ob es hilft, dass die französische Politikerin in Washington den Teufel an die Wand malt? Christine Lagarde, die Chefin des Internationalen Währungsfonds, behauptet, dass die Folgen für das Land "ziemlich schlecht bis sehr, sehr schlecht" wären, sollte Großbritannien aus der EU ausscheiden. Den Briten drohe eine Rezession. Hilft es, wenn der konservative Premierminister David Cameron meint, mit dem sogenannten Brexit werde Britanniens Wirtschaft einen "unmittelbaren und nachhaltigen Rückschlag" erleiden? Nützt es den EU-Befürwortern, wenn der frühere britische Finanzminister Alistair Darling warnt, nach dem Ausstieg würde die Jugendarbeitslosigkeit steigen, und die Insolvenzen nähmen zu wie die Zwangsversteigerungen von Eigenheimen?
Solche Warnungen haben bisher nicht viel genützt. Ökonomische Fakten können die Befürworter des Brexits offenbar kaum davor bewahren, für einen historischen Fehler zu plädieren. Für viele Briten ist es keineswegs absurd, aus der EU auszusteigen, in welche die zweitgrößte Wirtschaftsnation der Gemeinschaft ohnehin erst mit Verspätung im Jahr 1973 eingetreten ist. Die Meinung, die Briten hätten den wirtschaftlichen Aufschwung der vergangenen Jahrzehnte auch ohne die EU geschafft, der Ausstieg aus dem Club sei ein "affordable loss", ein Verlust, der locker zu verkraften wäre, sorgt auf dem Kontinent dagegen für Kopfschütteln.
Ausgerechnet die Briten setzen auf ökonomischen Provinzialismus
Die Kontinentaleuropäer verstehen die Briten mal wieder nicht. Wie kann man nur?, fragen sich die Deutschen. Wer kann so töricht sein, aus dieser Gemeinschaft austreten zu wollen? Gerade ein Land wie Großbritannien, das den großen Ökonomen Adam Smith hervorgebracht hat, der als Begründer des wirtschaftlichen Liberalismus gilt, der freies Handeln und freien Handel zum obersten Handlungsprinzip der modernen kapitalistischen Gesellschaft erklärt hat? Ausgerechnet die Briten, die die industrielle Revolution auslösten und die einst Gründer eines weltweiten Empires waren, setzen auf ökonomischen Provinzialismus. Fast die Hälfte der Briten kann sich mitten in einer globalisierten Welt ein modernes Großbritannien ohne Zugehörigkeit zur EU vorstellen. Die Zahl der Befürworter der Ausstiegs nimmt zwar inzwischen etwas ab. Doch noch immer besteht die Befürchtung, die Befürworter des Austritts könnten das Referendum wirklich gewinnen.
Der britische Brexit-Streit zeigt, dass die Wirtschaft auch im Mutterland des Kapitalismus keine Richtschnur für politisches Handeln liefert. Selbst Unternehmer votieren auf der Insel für den Ausstieg, obwohl sie wissen müssten, dass auch das Vereinigte Königreich seinen Wohlstand dem Handel mit der Welt verdankt. Mit Prozentsätzen, Wachstumsraten oder Arbeitslosenquoten lassen sich keine Herzen gewinnen. Die austrittswilligen Briten lassen sich nicht von ökonomisch gebotener Vernunft leiten. Sie haben ein Herzensthema, es ist britische Emotion, die es seit Jahrhunderten gibt und die zur DNA der Inselbewohner gehört: Britannien ist anders, Britannien setzt seine Maßstäbe selbst, Britannien lässt sich von niemandem etwas vorschreiben, auch nicht von Brüssel.
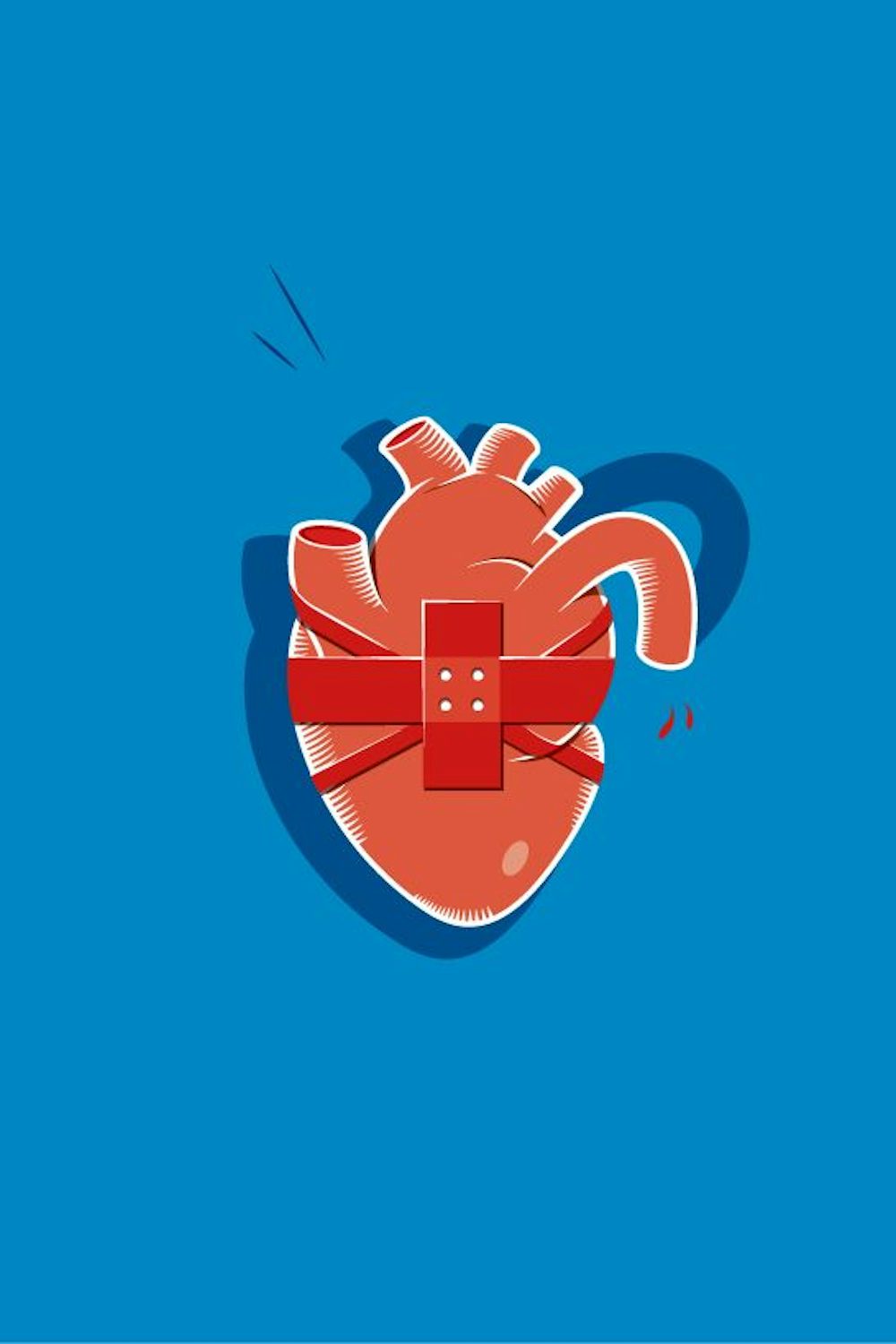
Der Hang zur "Splendid Isolation", der wunderbaren Abgewandtheit von anderen Mächten, bleibt. Auch wenn sich die ökonomischen Gewichte der Welt nach Asien verschieben und der von den Briten bevorzugte Partner Amerika Gefahr läuft, die wirtschaftliche Führungsrolle in der Welt an China abzugeben. Der Traum vom Britannien, das allein den Weltäuften trotzt, kann das Herz erwärmen und begeistern. Wie sonst konnte Londons bisheriger Bürgermeister Boris Johnson mit der dümmlichen Behauptung auf Stimmenfang gehen, in der Geschichte seien die Versuche, Europa unter ein Dach zu bringen, tragisch gescheitert: "Einmal durch Napoleon, einmal durch Hitler". Ernüchtert muss der in den USA lehrende britische Historiker Harold James feststellen, die Brexit-Debatte sei nur schwer zu erklären: "Mit Vernunft kommt man ihr nicht bei."
Die Briten sind vorbildliche Demokraten und Freiheitsliebhaber, die sich über Jahrhunderte der Knechtschaft fremder Herren oder Länder widersetzt haben. Deshalb haben sie auch etwas gegen Brüssel, den Verwaltungsmoloch, der angeblich für 50 Prozent der Gesetze verantwortlich ist, von denen die britische Wirtschaft betroffen ist, obwohl nur ein paar Prozent der Insel-Firmen nach Europa exportieren. Sie haben etwas gegen die Herrscher des Euro im gläsernen EZB-Turm in Frankfurt und bleiben lieber bei ihrem Pfund. Darüber entscheiden sie selbst und nicht die Vertreter der 19 Euro-Länder von Portugal bis Estland rund um den Italiener Mario Draghi. Auch der klare Abwärtstrend ihres Pfunds als Folge des drohenden Brexits hat die Freunde des Ausstiegs nicht davon überzeugen können, dass die EU auch auf der Insel für eines gut ist: fürs Geschäft.
Erstaunlicherweise sehen die Briten ihren wirtschaftlichen Erfolg der vergangenen Jahrzehnte kaum als Folge der EU-Zugehörigkeit. Das unterscheidet sie von anderen EU-Ländern, besonders von den sechs, die Ende 1957 die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) gründeten, den Vorläufer des Europas der 28 von heute. Für Deutschland, Frankreich, die Niederlande, Belgien, Italien, Luxemburg bot die EWG die positive Erfahrung eines beschleunigten wirtschaftlichen Aufstiegs aus der Nachkriegsmisere. Da die EWG und die nachfolgende EU auch ein Friedensprojekt von Gegnern des Zweiten Weltkriegs war, wurde sie für die Kontinentaleuropäer zur Herzenssache, besonders für die Deutschen.
Das war für die Briten anders. Sie kamen erst 1973 hinzu. Da waren die ersten großen Wachstumsschübe schon vorbei. Den Briten fehlt daher das kollektive Erlebnis der Wachstumsmaschine Europa. Für sie ist Brüssel seit 43 Jahren der verhasste Moloch, der ihnen ihr Geld wegnimmt und sie fremd bestimmt. Die Briten glauben, eine Alternative zu haben. Sie haben traditionell ein besonders Verhältnis zu den USA, der wichtigsten Wirtschaftsmacht der Welt. Sie haben noch immer gute Verbindungen zu ihrem lange abhandengekommenen Empire und glauben, auch ohne offizielle Zugehörigkeit zum offiziellen Brüssel-Europa erfolgreich sein zu können. Die Debatte um den Brexit offenbart aber, dass der Satz des US-Außenministers Dean Acheson von Anfang der Fünfzigerjahre noch immer nicht entkräftet ist. "Das Weltreich ging ihnen verloren", umriss Acheson das Dilemma der Briten, "doch eine neue Rolle haben sie nicht gefunden." Die Briten verweigern sich Europa, sie wollen nicht dazugehören, sie sehen sich lieber virtuell mitten im Atlantik, genau zwischen Amerika und den Europäern. Wahrscheinlich sitzen sie aber längst zwischen allen Stühlen.
Wie will Großbritannien verhehlen, dass es zu Europa gehört, nicht nur geografisch? Es hat den alten Kontinent beeinflusst wie kaum ein anderes Land. Die von England ausgehende industrielle Revolution hat zunächst den Kontinent auf den Kopf gestellt. Nach Amerika zog sie erst viel später weiter. Adam Smith, der schottische Begründer der modernen ökonomischen Theorie, hat große Teile seines die Welt verändernden Werkes in Paris geschrieben. Und wo hat der Deutsche Karl Marx, der große Theoretiker und Kritiker des Kapitalismus, seine Gedanken verfasst? In London. Die britische Hauptstadt ist das Finanzzentrum Europas und nicht Frankfurt. Auch am Rande Europas kann man eine zentrale Rolle spielen.
Die Deutschen sollten Verständnis aufbringen
Es kann aber für die Kontinentaleuropäer nicht genügen, über diese merkwürdigen Briten verständnislos den Kopf zu schütteln. Sie sollten sich die Mühe machen, die Motive der EU-skeptischen Briten genau anzusehen. Daraus lässt sich eine Menge lernen. Stimmt es denn nicht, dass der Euro nach zahllosen Schuldenkrisen und quälenden Griechenland-Debatten keine strahlende Erfolgsgeschichte ist? Die Deutschen, die das Wirken der EZB und ihres Präsidenten Mario Draghi so ungemein kritisch sehen, sollten Verständnis dafür aufbringen, dass andere bei der Gemeinschaftswährung gar nicht erst mitgemacht haben.
Auch in Deutschland gibt es Frust über Brüssel, jenen Verwaltungsapparat, der sich in Belange einschaltet, die national besser gelöst werden können, vielleicht sogar besser regional. Europa begegnet seinen Menschen oft als seelenloser Moloch, der das deutsche Reinheitsgebot für Bier als Handelshemmnis einstuft und französischen Weichkäse für ein Gesundheitsrisiko hält. Die EU ist für viele Deutsche der intransparente Machtapparat, der ihnen Geld wegnimmt, damit andere Schulden machen können. Die EU hat auch in Kerneuropa viel Unterstützung verloren. Sie wird mehr ertragen als geschätzt.
Die EU muss sich verändern: Sie muss nicht nur den Briten, sondern auch den Menschen auf dem Kontinent zeigen, dass diese Union es verdient, eine Herzenssache zu werden. Nur ein Wirtschaftsblock Europa mit seinen 500 Millionen Menschen hat die Chance, den offensiven ökonomischen Großmächten Amerika und China etwas entgegenzusetzen. Der EU geht es heute wie den Briten nach dem Zweiten Weltkrieg: Auch Europa hat seine Rolle in der Welt noch nicht gefunden, wie sich in den trostlosen Debatten über das transatlantische Handelsabkommen TTIP zeigt, das angeblich nur amerikanischen Interessen dient und die armen Europäer unterjocht. Europa ist keineswegs schwach. Es macht sich aber klein.
Wenn es nicht gelingt, Europa wieder zur wärmenden Idee zu machen, werden sich schnell andere Länder finden, für die eine Zugehörigkeit zur EU mehr Last ist als Nutzen, und die über den Austritt nachdenken. Die Brüsseler Spitzen in Behörden, Kommission und Rat sollten in sich gehen und darauf achten, dass ihre Arbeit nicht als politische Gängelung verstanden wird. Das mögen nicht nur die Menschen nicht, es ist auch nicht im Sinne der Wirtschaft. Das wusste schon der alte Brite Adam Smith. Der hat gesagt, dass der Einzelne, der um sein eigenes Wohl besorgt ist, im Austausch mit anderen mehr zum Wohl des Ganzen beiträgt als ein Politiker, der dem großen Ganzen nützen will. Das kann Europa von dem großen Briten lernen.