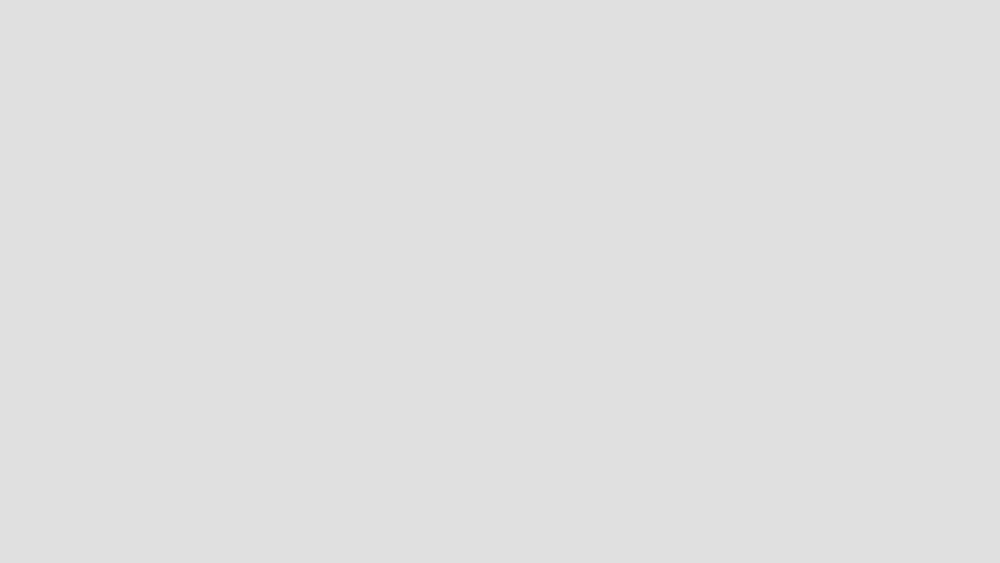Es gibt ein paar Dinge, die einem bei einer Begegnung mit Meg Whitman sofort auffallen: Sie geht ein wenig nach vorne gebückt. Sie trägt eine herrlich altmodische Perlenkette zum schwarzen Hosenanzug. Ihr Handschlag ist zurückhaltend, in Verbindung mit dem leisen "Hallo" wirkt sie gar schüchtern.
Natürlich sind solche Details völlig irrelevant bei der Beschreibung eines Menschen - und doch hebt sich die Geschäftsführerin von Hewlett Packard Enterprise (HPE) genau dadurch ab von den vielen Silicon-Valley-Chefs, die betont aufrecht und breitschultrig auf einen zuschreiten, ihren von Soulcycle und veganen Shakes gestählten Körper unter einem möglichst unauffälligen T-Shirt zur Schau stellen und einem bei der Begrüßung mindestens zwei Finger verstauchen.
Für Sentimentalitäten wie etwa jene von der berühmten Garage, gibt es keinen Platz
In der Fernsehserie Silicon Valley werden diese Mensch gewordenen Klischees auf wunderbare Weise persifliert: Der verpeilte Narziss Erlich Bachmann ist eine Mischung aus Sean Parker (Facebook) und Alexis Ohanian (Hipmunk), der neurotische Firmenchef Gavin Belson ist eine nicht mal überzeichnete Version von Larry Page (Google), Larry Ellison (Oracle) und Marc Benioff (Salesforce), der ahnungslose Programmierer Bighead Bigetti ist so wie jeder einzelne Google-Mitarbeiter. Die Serie ist genau deshalb so komisch, weil sie - glaubt man den Menschen, die seit Jahren dort arbeiten - eher ein Dokumentarfilm ist als eine überdrehte Sitcom.
Wen es nicht gibt: jemanden wie Meg Whitman. Die ist keine Silicon-Valley-Geschäftsführerin, die mit aktuellen Modewörtern (derzeit: Disruption, Agilität, Anpassung) um sich wirft und wie alle anderen behauptet, die Welt zu einem besseren Ort machen zu wollen. Sie wirkt in ihrem Pragmatismus eher wie eine große Schwester, die den kleinen Geschwistern erklärt, dass man für ein schöneres Haus vielleicht erst einmal das eigene Kinderzimmer aufräumen könnte, anstatt dauernd von noch mehr Spielsachen zu träumen.
Mit dieser Strategie hat Whitman, 59, innerhalb von fünf Jahren nichts weniger geschafft als die Rettung von Hewlett Packard. Das Unternehmen gibt es seit 1938 und damit in Silicon-Valley-Jahren in etwa so lange, wie die Menschen nicht mehr in Höhlen hausen. Es galt lange Zeit als Hardware-Dinosaurier, der die Ankunft der Eiszeit verschlafen hat und nun aussterben soll. Für Sentimentalitäten wie etwa jene, dass diese Firma von zwei Stanford-Absolventen in einer Garage gegründet worden ist, gibt es keinen Platz. Wer sich nicht anpasst, und auch das ist einer der Mode-Ausdrücke derzeit, der soll gefälligst sterben.
Vor fünf Jahren arbeiteten 350 000 Menschen in der Firma, davon fürchteten 350 000 um ihren Arbeitsplatz. Der Aufsichtsrat verpflichtete Whitman als Geschäftsführerin: Absolventin der Harvard-Business-School, ausgebildet bei Unternehmen wie Proctor & Gamble, Disney und Hasbro, Silicon-Valley-gestählt als Chefin von Ebay (1998-2007) und zusätzlich abgehärtet als erfolglose Kandidatin für das Amt der Gouverneurin von Kalifornien. Whitman sprach bei ihrem Amtsantritt nicht von Expansion oder Wachstum, sondern mahnte zu Bescheidenheit und Einsparungen - Begriffe, die Manager im Westen der USA gewöhnlich meiden wie sonst nur glutenhaltiges Essen.
Es ist nicht übertrieben zu behaupten, dass Whitman mit einer Keule durch dieses Unternehmen gelaufen ist. Die Höhepunkte dabei waren die Spaltung in zwei neue Firmen (den Hardware-Bereich HP Inc mit nun 50 000 Angestellten und das Software-Segment HPE mit 240 000 Mitarbeitern) im Herbst vergangenen Jahres sowie das Abstoßen der Service-Sparte durch eine Fusion mit dem Konkurrenten Computer Sciences Corporation, die im März 2017 abgeschlossen sein soll.
Sie lädt junge Start-Up-Chefs ein und lässt sich Ideen erklären, während sie im Garten arbeitet
"Viele Leute verwalten lieber große Unternehmen", sagt Whitman: "Es kann aber einfacher sein, zwei kleine Firmen zu steuern. Ich glaube deshalb, dass es richtig war, diesen mutigen Schritt zu wagen." Die ersten Resultate sind nun zu beobachten: Der Umsatz des nun von ihr geleiteten Unternehmens HPE stieg im vergangenen Quartal zum ersten Mal seit fünf Jahren, um ein Prozent auf 12,71 Milliarden Dollar - der Nettogewinn lag bei 42 Cent pro Anteil, der Aktienkurs ist seit Februar 70 Prozent gestiegen. Die Firma schrumpfte, um wieder zu wachsen: "Ich habe gesagt, dass so eine Sanierung normalerweise fünf Jahre dauert. Das hat sich bewahrheitet."
HPE soll dabei laut Whitman kein Silicon-Valley-Platzhirsch mehr sein, sondern ein Partner für Start-ups: "Unsere Stärken liegen in der Expertise. Wir müssen unseren Kunden zuhören und Lösungen für sie finden. Wir können Leistungen anbieten und sie mit anderen Partnern zusammenbringen. Dort liegt unsere Stärke." Die Hardware-Sparte wirkt nun aufgrund der Erfahrung und einer Vielzahl von Patenten im Internet-der-Dinge-Zeitalter nicht mehr existenzgefährdet, sondern wie eine interessante Spezies, mit der sich eine Symbiose lohnt. Das von Dion Weisler geleitete Unternehmen produziert etwa einen 3-D-Drucker, der knapp die Hälfte seiner Ersatzteile selbst druckt.
Das Faszinierendste an dieser Rettung ist nicht die Sanierung selbst, sondern wie sie Whitman gelungen ist. Sie gilt trotzdem nicht als knallharte Sparfrau, als eiskalte Managerin wie etwa Marissa Meyer von Yahoo. Wer mit Whitman zu tun hat, der beschreibt sie als geduldige und warmherzige Person, als einen der wenigen Menschen im Silicon Valley, die einem tatsächlich zuhören, anstatt nur darauf zu warten, endlich selbst wieder reden zu dürfen. Die junge Start-up-Chefs zu sich nach Hause einlädt und sich Ideen erklären lässt, während sie selbst im Garten arbeitet. Die zwar in ihrer Laufbahn ein Vermögen von 2,1 Milliarden Dollar angehäuft hat, bei einer Begegnung aber eher wirkt wie eine Politikerin, die freundlich um Stimmen wirbt.
Vor acht Jahren wurde sie von der New York Times mal als eine der aussichtsreichsten Kandidatinnen bezeichnet, die erste Präsidentin der Vereinigten Staaten zu werden. Danach scheiterte sie als Gouverneurs-Kandidatin. Ihre aktuelle Leistung ist nicht weniger wert: Sie hat eines der symbolträchtigsten Unternehmen gerettet - und sie ist so vorgegangen, dass sie noch nicht einmal als typische Silicon-Valley-Chefin persifliert werden kann.