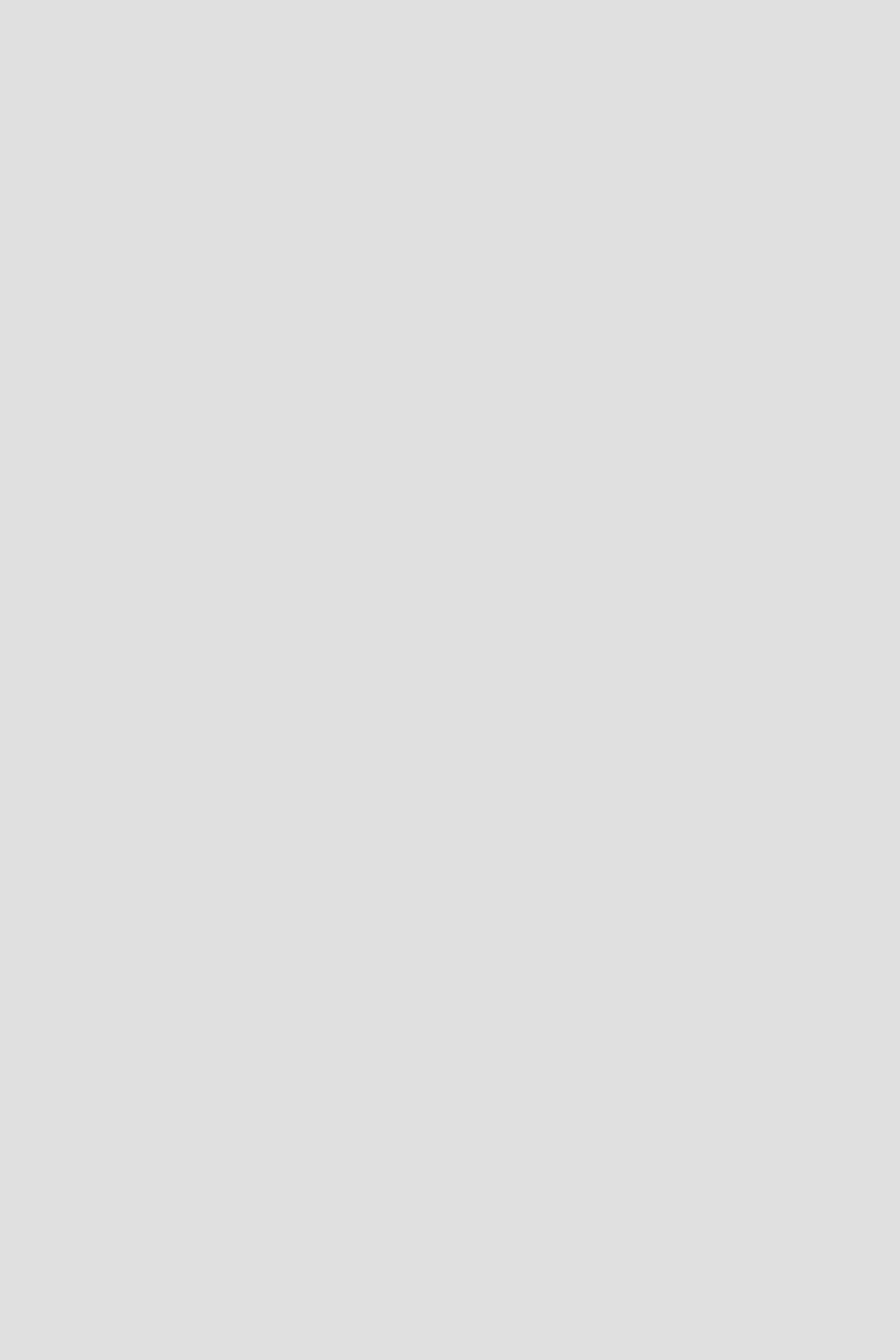Andy Warhol liebte Geld. Anfang der Sechzigerjahre war der junge Künstler auf der Suche nach neuen Motiven und bat ein paar New Yorker Freunde um Rat, was er als nächstes malen solle. "Na ja, was liebst du denn am meisten?", fragte ihn eine Bekannte. "Und so habe ich dann angefangen, Geld zu malen", erzählte Warhol einmal. So wie er hatte das noch niemand gemacht. Warhol hat das Geld selbst gemalt: Dollar-Noten. Zuerst im Jahr 1962 brachte er noch mit der Hand einen einzigen Schein auf die Leinwand, später folgten Dutzende im Siebdruckverfahren - Warhol druckte Geld in Serie.
Es war eine kleine Revolution in der Kunst - und eine, die perfekt in die Zeit passte. Denn die 60er- und 70er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts waren auch eine Zeit der Revolution des Geldes an sich, der Geldpolitik. Das Geld bekam eine neue, große, eigene Rolle: als Papiergeld, nicht mehr an Gold gekoppelt. Warhol gab ihm eine neue, eigene Rolle in der Kunst.
Das Geld selbst war seit seiner Erfindung Kunst. Die Griechen, Sumerer und Römer pressten Köpfe und Tiere auf ihre Münzen, über das Design diskutieren die Menschen seit Jahrhunderten. Und Geld war nicht nur Kunst, es war auch in der Kunst, zum Beispiel in Renaissance-Porträts von Geldwechslern oder Karikaturen von Steuereintreibern im 16. Jahrhundert.
Aber bis Warhol war das Geld nie das, wofür sich der Künstler in seinem Werk interessierte, die Münzen waren nicht wegen ihres materiellen Wertes, sondern wegen ihrer gesellschaftlichen Funktion im Bild, sie sollten etwas veranschaulichen: Reichtum und Armut, Macht und Unterdrückung, Habgier und Geiz. In Warhols Siebdrucken dagegen ist außer den Dollar-Scheinen nichts zu sehen. Was sie bedeuten, ist Interpretation.
Während Warhol Dollars druckte, wurde der von der amerikanischen Notenbank Fed gedruckte Geldschein vom bloßen Symbol zu einer Art eigenständigem Wertgegenstand, der sich quasi unendlich vervielfältigen lässt. Über Jahrzehnte hinweg hatte es, mit Unterbrechungen, das globale Währungssystem des Goldstandards gegeben. Ende des 19. Jahrhunderts hatten alle großen Staaten den Preis ihrer Währungen an den des Goldes gebunden. Es war genau festgelegt, wie viel Gold man für einen Dollar oder eine Reichsmark bekommen würde. So waren faktisch auch die Austauschkurse der Währungen festgelegt.
Das Vertrauen in Papiergeld beruhte darauf, dass es von jedermann jederzeit umgetauscht werden konnte, Geldscheine waren nichts als ein Anspruch auf einen Wechsel in Gold. Doch das System hakte, vor allem weil die Geldmenge an die Menge physisch vorhandenen Goldes gebunden war. Während der zwei Weltkriege und der Weltwirtschaftskrise der Dreißigerjahre wurde die Goldbindung zeitweise ausgesetzt und immer weiter abgemildert. Es musste eine neue Lösung her, die den Welthandel wieder ankurbelte.
Im Juli 1944, die Landung der Alliierten in der Normandie war nicht einmal einen Monat her, lud der damalige US-Präsident Franklin D. Roosevelt die Vertreter von 44 Verbündeten in das Bergdorf Bretton Woods, um eine neue Finanzordnung zu entwerfen. Viele seiner Gäste hatten den Goldstandard noch in guter Erinnerung und hofften, dass er Hyperinflationen wie in den Dreißigerjahren verhindern könnte. Aber sie hatten in den Krisen auch gelernt, dass Volkswirtschaften die Möglichkeit brauchen, sich an extreme Änderungen der Wirtschaftslage anzupassen. Denn mit dem Goldstandard haben Zentralbanken nicht viel Spielraum, mit Geldpolitik die Wirtschaft zu stabilisieren, sie können nicht mehr Geld drucken, wenn genau dies nötig wäre, um eine noch größere Krise zu verhindern.
Das Ergebnis von Bretton Woods: Die Wechselkurse wurden festgelegt. Doch wenn Änderungen unvermeidbar wurden, konnten Auf- oder Abwertungen beschlossen werden. Für alle Währungen sollte ein fixer Kurs zum Dollar gelten und die USA garantierten den ausländischen Notenbanken, Dollar jederzeit zum Kurs von 35 Dollar per Unze Gold zurückzunehmen. Allerdings schrieb der Vertrag nicht vor, dass die Dollarmenge im Umlauf von den Goldvorräten gedeckt sein muss - anders als im klassischen Goldstandard. Die Idee wurde Wirklichkeit und funktionierte zunächst, die Weltwirtschaft boomte, Europa erholte sich vom Krieg, die Länder handelten munter miteinander.
Der frühere US-Präsident Richard Nixon hat die Goldbindung aufgehoben
Aber das System hielt nicht lange. Während Warhol seinen ersten Dollar malte, verlor die Finanzwelt nach und nach den Glauben an die Amerikaner und damit das Vertrauen in den Dollar. 1964 überstiegen die ausländischen Dollarreserven den Wert der Goldbestände. Es war klar, dass die USA gar nicht alle Dollar in Gold tauschen könnten. Die Kriege in Vietnam und Korea waren teuer für die USA, sie brachten immer mehr Dollar zur Kriegsfinanzierung in Umlauf. Der Goldpreis auf dem freien Markt stieg weit über 35 Dollar. 1971 entschied der damalige US-Präsident Richard Nixon, dem Dollar neue Freiheit zu geben. Er hob die Gold-Umtauschpflicht auf.
Von diesem Zeitpunkt an war die Weltleitwährung Dollar nur mehr eine Papierwährung, die beliebig vermehrt werden konnte - was auch den Grundstein legte für die Rettungsaktionen der Notenbanken in der Finanzkrise. Das Ereignis ging als "Nixon-Schock" in die Geschichte ein, mit anderen Nationen hatte er sich nicht abgesprochen. Die Inflation beruhigte sich zunächst, aber die Ruhe war nicht von Dauer, die Siebzigerjahre wurden zum Krisen- Jahrzehnt.
Seither jedenfalls war Warhols geliebter Dollar Fiatgeld, so nennt man Zahlungsmittel ohne inneren Wert, denen lediglich durch eine Regierungsinstanz der Wert zugesprochen wird. Der Begriff entstammt dem lateinischen Wort "fieri", also "es möge entstehen", siehe Bibel: "fiat lux!" - "es werde Licht!" Und dieses Fiatgeld sollte, so der Konsens im freiheitsliebenden Amerika, so frei sein wie möglich. Der Markt bestimmt das Geld - und die Welt.
Da mag es kaum stören, dass der Begriff Papierwährung eigentlich falsch ist: Dollar-Scheine bestehen zu drei Vierteln aus Baumwolle und zu einem Viertel aus Leinen. Früher stammte ein Teil des Materials aus den Schnittresten der Jeans-Fabriken. Seit 1879 stellt die Firma Crane aus Boston die Dollar-Stofflappen her, Crane ist Banknoten-Weltmarktführer, mehr als 50 Zentralbanken gehören zu den Kunden - letztlich ist das meiste Geld der Welt aus dem gleichen Stoff gemacht.
Warhols Geldschein-Drucke sind das perfekte Abbild dieser Entwicklung. So wie seine Siebdrucke können die Dollars beliebig vermehrt werden. Die Kunst, auf Leinwand gemalt oder gedruckt oder das Geld, auf Baumwoll-Leinen-Lappen gedruckt: Beide sind an sich wertlos, bis der Mensch ihnen einen Wert gibt.
Geld hat keine Moral. Es kann es alles bedeuten oder nichts
Warhol unterläuft allerdings seinen eigenen Grundgedanken, den der Reproduzierbarkeit, denn in seinem Druck der 40 Zwei-Dollar-Noten sieht kein Schein aus wie der andere. Der Druck gerät mal dicker, mal dünner. Warhol machte den Dollar zur Pop-Ikone, was ihn gleichzeitig erhöhte und banalisierte - Geld, nur eine Sache, so wie Dosensuppe. Warhol malt das Alltägliche, das Austauschbare - und nichts ist austauschbarer als ein Geldschein, der zum Zwecke des Tausches erfunden wurde. Geld hat keine Moral, es kann alles bedeuten oder nichts. Es ist weder gut noch böse, weder mystisch noch religiös. Es liegt im Auge des Betrachters, ob er den Schein als den Ermöglicher oder Verhinderer sieht. Er kann Warhol für einen großen, ironischen Konsumkritiker halten oder für einen, der genau das verehrt.
Der Künstler selbst gab in seinem Buch und seinen wenigen Interviews allerdings nie Anlass für die erste Interpretation. "Kaufen ist amerikanischer als Denken. Und ich bin so amerikanisch, wie man nur sein kann", sagte er selbstironisch. "Das Großartige an diesem Land ist, dass Amerika die Tradition begann, dass die reichsten Konsumenten im Grunde die gleichen Dinge kaufen wie die ärmsten. Du schaust fern und siehst Coca-Cola und du weißt, dass der Präsident Coke trinkt, dass Liz Taylor Coke trinkt, und - stell dir vor! - auch du kannst Coke trinken."
Dass Warhol Geld liebte, lag sicher auch an seiner Vergangenheit. Warhol wuchs als Sohn slowakischer Einwanderer in kleinen Verhältnissen in Pittsburgh auf, der Vater starb früh. Der junge Warhol (eigentlich Andrew Warhola) war oft krank. Seine geliebte Mutter gab ihm Malbücher, er liebte die Kinostars seiner Zeit. In der Schule hatte er kaum Freunde. Später schickte die Mutter ihn zur Kunsthochschule in Pittsburgh, damit der American Dream in ihrem Sohn Wirklichkeit werde. Und wie er wurde!
Warhol brachte seine Bilder massenhaft auf den Markt. In seiner "Factory" in New York produzierte er Drucke wie am Fließband. Es hat etwas Ironisches, dass Warhol Geld generierte, indem er Geld malte beziehungsweise druckte, und die Leute zahlten sehr viel mehr, als Warhol abbildete. Seine Kunst wurde zum Asset, zum Anlageobjekt. Das Geldverdienen selbst sei Kunst, sagte er. 2009 versteigerte Sotheby's in New York einen Druck der "200 One Dollar Bills" für fast 44 Millionen Dollar. Die erste, handgezeichnete Dollar-Note ging 2015 für 32,8 Millionen Dollar weg. Es ist die Manifestation von Joseph Beuys' Leitspruch von "Kunst = Kapital".
Geld verschwand nie wieder aus der Kunst. Beuys nutzte Banknoten für seine Botschaften; auf einen 20-Ostmark-Schein schrieb er zum Beispiel "Falschgeld". Robert Morris beklebte zwischen 1963 und 1964 ein Gehirn aus Plexiglas mit Dollarscheinen. Und heute arrangiert die deutsche Fotografin Annette Kelm in ihren Motiven das Geld wie Blätter an den Bäumen, eine dreiteilige Serie aus dem vergangenen Jahr heißt passenderweise Money Tree. Warhol hätte das gefallen. "Ich liebe es", sagte er einmal, "Geld an die Wand zu hängen."
"Gutes böses Geld. Eine Bildgeschichte der Ökonomie" ist eine Ausstellung der Staatlichen Kunsthalle Baden-Baden (5. März bis 19. Juni). In Kooperation mit Casino, Stadtmuseum und Theater Baden-Baden. Die Süddeutsche Zeitung begleitet die Ausstellung mit dieser Serie. Und außerdem mit der Gesprächsreihe "Reden wir über Geld" mit Ökonomen: Am 3. Mai diskutiert die SZ mit Clemens Fuest in der Kunsthalle über gutes und böses Geld, am 7. Juni mit Marcel Fratzscher über Ungleichheit. Infos: www.kunsthalle-baden-baden.de Bilder zur Verfügung gestellt von der Staatlichen Kunsthalle Baden-Baden.