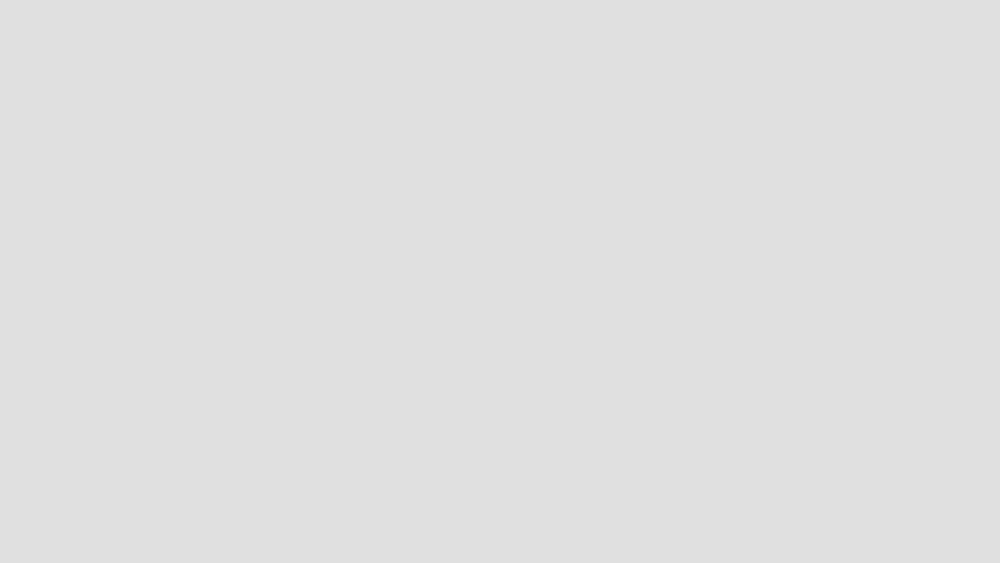Es ist Herbst in Berlin, vor den Galerien bilden sich nach der langen Sommerpause wieder schwarze Menschentrauben. Alle rauchen, alle trinken, und natürlich sind alle da: Die Schönen, denen selbst unvorteilhaft geschnittene Mom-Jeans nichts anhaben können. Die Nicht-so-Schönen, die Dank ihres sorgfältig unsorgfältigen Stylings zumindest interessant aussehen. Nur die Reichen, tja, die zieht es noch immer nicht nach Berlin. Kein Jimmy-Choo-Geklackere auf den Trottoirs, keine Bentley-Rolls-Royce-Porsche-Schlangen vor den Hot Spots der Kunstszene in Mitte, Kreuzberg oder Tiergarten. Außer zum Gallery Weekend im Frühling werden die großen Deals weiterhin woanders gemacht.
Egal. Die Berliner Kunstszene versteht sich als Avantgarde, auch modisch gesehen. Hier shoppen weder juwelenbehängte Milliardärsgattinnen was Hübsches für die Wände des Zweit- und Drittwohnsitzes, noch investieren Jungspunde im maßgeschneiderten Fiat-Erben-Stil in krisensicheres Öl-auf-Leinwand. Stattdessen gilt die Kunst-Crowd als erste Adresse für die neuesten Modetrends. Vergesst Street-styler und It-Girls, was angesagt ist, lässt sich heutzutage am besten an den Körpern von Kunstfreunden besichtigen.
Mehrheitlich sieht das aus wie überall auf der Welt auch. Fast alle tragen Schwarz, in allen Nuancen von Tiefschwarz bis Nochvielschwärzer. Gallerinas, also die jungen, hübschen, top ausgebildeten weiblichen Angestellten der größeren Galerien wie Sprüth Magers oder Contemporary Fine Arts kombinieren schon mal mit Grau oder Weiß. Zu sehen sind die üblichen In-Labels von Acne bis Maison Margiela. Dazu malen sich die Frauen auf die gute alte Pariser Art die Lippen knallrot an, während mutige Männer ihre Füße in ein Paar frech gemusterte oder monochrom bunte Socken stecken - wenn sie nicht mit Bart, Basecap und Holzfällerhemd den Standard-Hipster-Look bevorzugen.
Die weiblichen Silhouetten sind exakt so, wie es die Designer für diesen Herbst vorgesehen haben. Egal, ob in der zum Galerieraum umfunktionierten Betonkirche von Johann König oder im Me Collectors Room des Firmenerben Thomas Olbricht: Oversize-Mäntel drüber, darunter zugeknöpfte Blusen oder grobmaschige Strickpullis, alles reingesteckt in den Bund von weiten, wadenlangen Culotte-Hosen. Dazu ausnahmslos: flache Schuhe. Absätze, gar High Heels sind von gestern. Sogar bei der Technoparty, die das neue Springer-Kunstmagazin Blau zum Gallery Weekend in einem Stripclub schmiss, liefen nur noch Amerikanerinnen oder Russinnen so herum. Bei denen baumelten auch noch It-Bags von der Schulter. So etwas besitzen in Berlin allerhöchstens arrivierte Galeristinnen, Kuratorinnen oder Sammlerinnen jenseits der vierzig. Dann aber bitte schön von Céline.
Die Hauptstadt ist berühmt dafür, keinen Stil zu haben. Unvergessen ist die Bemerkung des Streetstyle-Bloggers Scott Schuman alias The Sartorialist, er finde auf den Straßen Berlins kaum Motive, die er gerne fotografieren würde. Natürlich liegt das auch an den vielen Menschen, die es sich schlicht nicht leisten können, sich gut anzuziehen. Bei der Kunstavantgarde aber darf man annehmen, dass nicht das leere Portemonnaie das Problem ist. Ihr geht es darum, auf keinen Fall so auszusehen, als verschwende man auch nur eine Minute zu viel vor dem Spiegel. Es gibt schließlich Wichtigeres auf der Welt, "spannende" Kunstprojekte in Weddinger Privatwohnungen zum Beispiel. Warum "spannend" eigentlich die Lieblingsvokabel der Galerie-Hopper ist? Weil sie maximal nichtssagend ist, vermutlich.
Beim hemmungslosen Konsum will niemand ertappt werden. Deshalb ist vieles secondhand
Stimmt natürlich nicht, dass sich in der Kunstwelt niemand Gedanken über seinen Kleidungsstil macht. Im Gegenteil. Auf Gallery Openings lässt sich wunderbar das "Sag mir, was du trägst"-Spiel spielen. Man lobt das Outfit einer x-beliebigen Besucherin und erhält garantiert eine der drei Antworten: "Ist secondhand", "Ist von meiner Oma" oder wenigstens "Das war im Sale". Beim hemmungslosen Konsum will schließlich niemand ertappt werden. Außerdem haben gebrauchte Klamotten den unschätzbaren Vorteil, dass sie eine Aura haben, die auf die Trägerin übergeht. Das ist nicht spirituell gemeint, obwohl hier, grob geschätzt, jede Dritte Yoga macht. Es geht um den Style, den Secondhand-Designersachen transportieren. Altes hat Patina und Tiefe, ist also das Gegenteil von oberflächlich. Es demonstriert, dass sich hier jemand auskennt, ein Insider ist. Der Blue-Chip der stilbewussten Kunstfreundin ist der sorgfältig kuratierte Look nach der Gleichung: ein Drittel Fashion + ein Drittel Vintage + ein Drittel Hässlichkeit.
Hässlichkeit? Aber hallo. Zu gefällig, harmonisch Ton-in-Ton oder sexy geht gar nicht. Allenfalls die Designer der ehrwürdigen Pariser Modehäuser kommen noch damit durch, wenn sie es als ihre Mission ansehen, mit ihren Kreationen Frauen "schöner" machen zu wollen. Hippe Konsumentinnen, besonders die in Kunstkreisen, achten darauf, vor allem Sachen zu tragen, die der Figur nicht schmeicheln, sondern sie skulptural verhüllen. Da ist die Mode nicht anders als die Kunst, sie muss edgy sein, um interessant, pardon, "spannend", zu wirken. Ein Erfolgsrezept, das sich übrigens auch auf Autos übertragen lässt. Der legendäre amerikanische Produktdesigner Chris Bangle soll bereits in den Neunzigern seine klobigen Siebener-BMWs nach der Devise "thirty percent uglyness" - dreißig Prozent Hässlichkeit - entworfen haben.
Sehr lustig anzusehen sind diejenigen Galeriebesucher, die mit ihren Outfits ungewollt berühmte Werke ihrer Lieblingskünstler interpretieren. Beim gediegenen Thomas Schulte sieht man Frauen in übergroßen, kastenartig geschnittenen Kleidern - Mensch gewordene schwarze Quadrate des russischen Futuristen Kasimir Malewitsch auf zwei Beinen. Bei Between Bridges, dem Ausstellungsraum des Fotografen Wolfgang Tillmans, sind es dürre Jungs in Skinny-Jeans und engen Shirts - wandelnde Schmerzensmänner, den berühmten Skulpturen von Alberto Giacometti nachempfunden.
Rund um die abgerissene Potsdamer Straße, dem relativ neuen Epizentrum der Berliner Kunstszene, trifft man zwischen Dalmacija-Grill und der rustikalen Joseph-Roth-Diele jetzt immer öfter demonstrativ schlecht angezogene Leute. Die Männer tragen uncoole Turnschuhe, Tennissocken, ausgewaschene Jeans. Die Frauen Jogginghosen, bedruckte Sweatshirts, Blousons aus Ballonseide. Es handelt sich hierbei aber nicht um Verlierertypen, die neben Import-Export-Läden auf der "Potse" abhängen. Sie sind super busy und verschwinden, nachdem sie sich im neuen, minimalistischen Café Tietz eine Soja-Latte geholt haben, in ihren Off-Projekträumen und setzen sich an ihre Laptops. Was wir hier sehen, ist die Speerspitze eines neuen, ultrahipen Trends. Einen Namen hat er auch schon: "Noncore".
Alle wollen am Ende das, worum es in der Mode immer geht: Distinktion
Der Begriff ist eine Weiterentwicklung des "Normcore"-Trends, der vergangenes Jahr von der New Yorker Trendagentur K-Hole in die Welt gesetzt wurde. Er setzt sich aus den Wörtern "normal" und "hardcore" zusammen und bezeichnete die immer größer werdende Masse derer, die sich betont durchschnittlich kleiden. Der "Noncore"-Trend dreht die Schraube noch ein paar Umdrehungen weiter - und endet in der Pose totaler Verweigerung. Das ist kein spezifisch deutsches Phänomen, seine Anhänger fühlen sich nur in Berlin besonders wohl. Sie sind unter 30 und mit dem Internet aufgewachsen. Der virtuellen Welt fühlen sie sich so verbunden, dass sie ihr Dasein in der schnöden Realität vernachlässigen. Das heißt aber nicht, dass "Noncore"-Anhängern Stil egal wäre. Im Gegenteil, er wird im Netz ausgelebt, das eine viel größere Reichweite bietet als das analoge Miteinander. Weil sich der Körper (noch) nicht in Bits und Bites auflösen lässt, wird er mit Gleichgültigkeit behandelt und in hässliche Klamotten ohne spezifische Gender-Merkmale gesteckt. Ob Mann oder Frau ist im "Noncore"-Zustand egal. Zumindest in der Theorie.
Das künstlerische Pendant zu "Noncore" ist die "Post-Internet-Art". Ob das ein Stil, eine Ästhetik oder eine ganze Kunstbewegung ist, weiß niemand so genau. Fest steht nur, dass deren Vertreter was mit Internet und Kunst machen und sie in ihren Videos und Installationen versuchen, Individualität zu überwinden. Weil das unglaublich modern und - man ahnt es schon - "spannend" klingt, also super zu Berlin passt, wurden einige der bekanntesten Vertreter der "Post-Internet-Art", das New Yorker Künstlerkollektiv DIS, gleich mal zu Kuratoren der nächsten Berlin Berlinale ernannt.
Egal, ob herkömmlicher Hipster oder "Noncore"-Anhänger, sie alle wollen am Ende das, worum es in der Mode - und möglicherweise auch beim Kunstgenuss - immer geht: Distinktion. Das Ich braucht eine Bühne und das passende Kostüm, um seine Einzigartigkeit zu zelebrieren und sich von der ahnungslosen Masse abzugrenzen. Moderne Galerien, diese minimalistischen, hell erleuchteten white cubes, sind dafür der ideale Laufsteg - und die darin ausgestellten Kunstwerke prima Requisiten für die große Ego-Show.