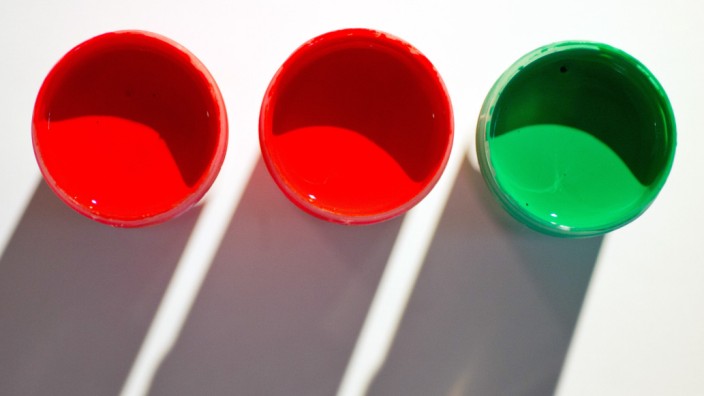Wann hat man in Berlin zuletzt ein freundliches öffentliches Wort von Linken-Politikern über ihre Kollegen von der SPD vernommen? Wann haben sie zuletzt darauf verzichten wollen, sich als die wahren Gerechtigkeitskämpfer darzustellen, die Halbherzigkeit und Heuchelei von Sozialdemokraten schonungslos entlarven? Ganz sicher nicht am Donnerstag, als die Linken-Vorsitzende Katja Kipping der SPD empfahl, die rechnerische Mehrheit aus SPD, Linken und Grünen im Bundestag zu nutzen und jetzt, sofort, die "Ehe für alle" durchzusetzen. Ähnlich verfuhr Fraktionschefin Sahra Wagenknecht vor ein paar Tagen. In der Talkshow von Anne Will blaffte sie ihre SPD-Kollegin Malu Dreyer an, warum deren Partei nicht endlich die "Mehrheit" im Bundestag nutze, um mit Linken und Grünen die sachgrundlose Befristung von Jobs zu verbieten.
Immer, wenn die Linken so kommen, drängt sich die Frage auf: Meinen die das ernst? Glauben sie wirklich, so lässt sich Politik machen? Dass Parteien zwar eine Koalition bilden, von dieser dann aber stundenweise eine Auszeit nehmen, um ein Projekt, über das man sich mit dem Partner nicht einig wird, mal kurz mit der Opposition durchzusetzen?
Man würde Kipping und Wagenknecht geradezu beleidigen, traute man ihnen ein solches Politikverständnis zu. Selbstverständlich sind ihre Appelle nicht wörtlich zu nehmen, selbstverständlich sind diese nicht an die SPD-Kollegen, sondern ans Publikum gerichtet. Sie zeigen aber auch, wie schwierig bis unmöglich ein rot-rot-grünes Bündnis im Bund weiterhin ist. Worin sollte zumindest vorab seine Attraktivität bestehen? Partner, die sich bereits angiften, bevor sie mit den Mühen des gemeinsamen Regierens konfrontiert sind, bedeuten für niemanden eine Verheißung. Partner, die bereits im Vorwahlkampf Aggressionen zeigen, können auch kaum eine gemeinsame Erzählung entwickeln.
Die Folge dieser zelebrierten Animosität ist, dass genau das passiert, was am Sonntag im Saarland passierte: Bürger, die grundsätzlich vielleicht zur SPD oder zum Nichtwählen aus Gleichgültigkeit neigen, machen ihr Kreuz auf einmal bei der CDU; ein Bündnis aus den rot-roten Freundfeinden wollen sie verhindern.
Persönliche Verbitterung spielt mit
SPD und Linke sind Parteien, deren Zuspruch sich daraus speist, was die Leute ihnen beim Thema Gerechtigkeit zutrauen. Es ist ein Thema, das immer emotional und moralisch aufgeladen sein wird und das Rechthaberei eher fördert als mäßigt. Ihr konstruktives Miteinander wird auch dadurch erschwert, dass viele Linken-Politiker während der Schröder-Jahre im Streit die SPD verließen; nicht zuletzt aus persönlicher Verbitterung arbeiten sie sich bis heute an ihrer Ex-Partei ab.
Wenn Kipping, Wagenknecht und Co. wegen Ehe für alle oder sachgrundloser Befristung ihre Appelle an die SPD hinausrufen, ist dies vor allem verklausulierte Rechthaberei. Es geht ihnen darum, möglichen Wählern klarzumachen, wer in Deutschland in Wahrheit die Partei der großen Gerechtigkeit sei. Solche Äußerungen mögen geeignet sein, die Linke bei der Bundestagswahl noch von acht auf neun oder 9,5 Prozent zu hieven. Zugleich handelt es sich bei ihnen um jene typischen Sticheleien, die dem angeblichen Ziel einer rot-rot-grünen Koalition objektiv entgegenwirken.
Die Erfahrung lehrt, dass Menschen, die inhaltliche und atmosphärische Probleme miteinander haben, auf eine Partnerschaft lieber verzichten sollten. Die Geschichte der SPD lehrt, dass die Partei oft genug schon damit überfordert war, wenigstens beisammenzubleiben; erst recht, wenn sie regierte. Mag sein, dass Rot-Rot-Grün im Wahlkampf eine Art Machtperspektive darstellt. Aber wehe, sie würde wahr.