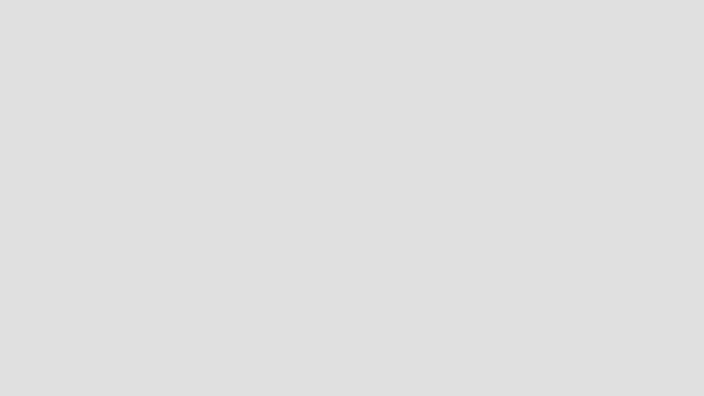John Boehner pflegt alte Gewohnheiten auch in der Krise. Morgens geht er spazieren, frühstückt im Stammlokal am Tresen und sucht dann sein Büro im Kapitol auf. Man sollte sich auf alte Gewohnheiten besinnen, sagt Boehner, der Anführer der Republikaner im Abgeordnetenhaus: In jeder Haushaltskrise der jüngeren Geschichte habe der Präsident irgendwann mit dem Parlament verhandelt.
Boehner kann sie alle aufzählen: Reagan, Bush, Clinton, Obama im Jahr 2011. Diesmal aber entziehe sich Präsident Barack Obama, und wenn er dabei bleibe, drohe eine Katastrophe. "Sie meinen, das Land ist zahlungsunfähig, wenn der Präsident sich weigert, zu verhandeln?", wurde Boehner jüngst gefragt. Der Republikaner antwortete: "Wir sind auf diesem Pfad."
Washingtons Widersacher haben sich so sehr in einander verkeilt, dass sich kaum mehr einer bewegen kann. Die Regierung ist nun schon die zweite Woche in Folge geschlossen, weil das Parlament keinen Haushalt genehmigt hat.
Aber das ist noch harmlos im Vergleich zu dem, was am 17. Oktober droht: Dann geht der Regierung das letzte Geld aus. Hebt das Parlament bis dahin nicht die Verschuldungs-Obergrenze an, könnten die USA keine neuen Kredite aufnehmen und wären zum ersten Mal in ihrer Geschichte faktisch bankrott.
Boehners Probleme
Unter den Männern im Zentrum dieser Krise muss Boehner wohl die schwierigste Aufgabe lösen. Als Speaker of the House ist er der dritthöchste Mann im Staat und steht damit besonders in der Verantwortung, die Regierung mit Geld zu versorgen. Gleichzeitig muss er seine republikanische Fraktion zusammenhalten, die ständig auseinanderdriftet. Dort geben zurzeit Tea-Party-Ideologen den Ton an, und das Abgeordnetenhaus hat mehrheitlich dafür gestimmt, dass Obama nur dann einen Haushalt bekommt, wenn er seine Gesundheitsreform verschiebt.
Boehner, 63, ein deutschstämmiger Geschäftsmann aus Ohio, hat im Parlament schon die Budgetkämpfe der Neunziger Jahre miterlebt. Auch damals musste die Regierung schließen, die Öffentlichkeit nahm es mehrheitlich den Republikanern übel. Auch die neueste Krise lastet das Volk nationalen Umfragen zufolge eher Boehners Partei an. Boehner weiß, dass die Machtprobe mit Obama nicht außer Kontrolle geraten darf, sonst könnten die Republikaner bei der Parlamentswahl im kommenden Jahr ihre Mehrheit verlieren.
In einem Fernseh-Interview am Wochenende hat Boehner dem Präsidenten die Schuld an der Eskalation gegeben. Obamas "Weigerung, sich mit uns zu unterhalten", gefährde die Zahlungsfähigkeit. Er sei das Wochenende über in Washington geblieben, um mit dem Präsidenten zu reden, aber der habe nicht angerufen.
Wie Obama seine Taktik änderte
Tatsächlich beteuert Obama, dass er nicht verhandeln werde. Seit dem Haushaltsstreit 2011 sieht er sich von den Republikanern ständig erpresst. Nach seiner Wiederwahl vor einem Jahr änderte er die Taktik. Es seien die zentralen Aufgaben des Parlaments, einen Haushalt zu beschließen und die Rechnungen zu bezahlen für alle Aufgaben, die der Kongress durch seine Gesetze selbst geschaffen habe, sagte er.
Obama hat die Wortwahl jetzt noch verschärft: Der Kongress könne kein "Lösegeld" verlangen dafür, dass er schlicht seine Arbeit mache. Bleiben Obama und Boehner also bei ihrer Haltung, droht der Staatsbankrott.
Anders als Obama hat Boehner seine Taktik zuletzt mehrmals ändern müssen. Nach Obamas Wiederwahl erklärte er, die Gesundheitsreform des Präsidenten (Obamacare) sei Gesetz und auch so zu akzeptieren. Noch im Juli kündigte er bei vertraulichen Gesprächen im Parlament einen Haushalt an, der zwar erhebliche Einsparungen vorsah, doch Obamacare unangetastet ließ.
Im Sommer aber, als die Abgeordneten in ihren Wahlkreisen waren, nahm eine Kampagne rechter Organisationen und Großspender gegen Obamacare an Fahrt auf, der rechte Senator Ted Cruz setzte sich an die Spitze der Bewegung. Dessen Forderung nahm die Fraktion dann auf: Entweder Obamacare bleibt aus, oder es gibt eben kein Geld.
Republikaner im "Schlamassel"
Boehner hatte sich den Herbst anders vorgestellt. Er wollte geräuschlos einen Haushalt verabschieden und dann die Frage der Schuldenobergrenze nutzen, um die Regierung zum Sparen zu zwingen. Stattdessen haben die Angriffe auf Obamacare dazu geführt, dass Präsident und Senat mehr noch als vorher auf stur geschaltet haben.
Allerdings hat nicht nur Obama die Republikaner mit Geiselnehmern verglichen: Etliche gemäßigte Republikaner sehen das genauso. Der kalifornische Abgeordnete Devin Nunes, ein Vertrauter Boehners, sagte, der Hardliner Ted Cruz habe die Partei mit seiner Obamacare-Strategie in einen "Schlamassel" geführt, er müsse nun einen Ausweg weisen. Cruz soll vor aufgebrachten Kollegen bekannt haben, dass er keinen Ausweg wisse.
Doch verantwortlich ist am Ende Boehner. Manche Beobachter glauben, dass auch er keinen Ausweg weiß und nur darauf hoffen kann, seine Fraktion so lange wie möglich zusammenhalten - bis sich die Republikaner in eine weitere Niederlage zu Obamacare fügen müssen. Andere glauben, Boehner schwebe ein neuer Kompromiss vor, der die Staatsausgaben eindämmen soll.
Boehner sagt, die Regierung habe in 55 der letzten 60 Jahre mehr Geld ausgegeben als sie eingenommen habe. Jeden Tag gingen 10.000 Amerikaner aus der Baby-Boomer-Generation in den Ruhestand. Deswegen werde er die Schuldengrenze keinesfalls anheben, ohne mit Obama über Amerikas "Ausgaben-Problem" geredet zu haben.
Es ist eine Sorge, die Boehner mit etlichen Amerikanern teilt, obwohl das Staatsdefizit neuerdings wieder sinkt. Boehner also beteuert, er wolle nur reden, was die Demokraten ablehnen, so lange sie sich erpresst fühlen. Bis zum 17. Oktober sind es noch neun Tage.