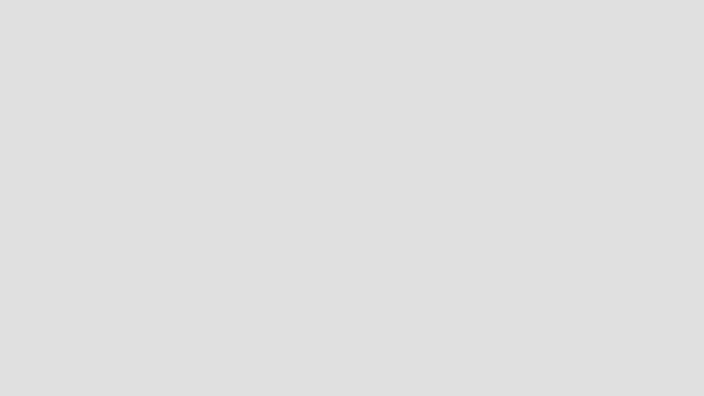Wenn so viele Psychiater im Raum sind, kann einem schon einmal ein Freud'scher Versprecher unterlaufen. Die Verhandlung des Bundesverfassungsgerichts zur Zulässigkeit von Zwangsmaßnahmen gegen psychisch kranke Patienten hatte gerade begonnen, als Richterin Doris König den anwesenden Klinikleitern und Psychiatriedirektoren das Thema kurz umreißen wollte. Es werfe ein Schlaglicht auf die "Finanzierung" in der Psychiatrie. Gemeint war aber die "Fixierung". Also die Tatsache, dass tobende Patienten in der geschlossenen Psychiatrie mitunter regelrecht gefesselt werden. Der weitere Verlauf der Anhörung sollte allerdings zeigen: Fixierung und Finanzierung haben so einiges miteinander zu tun.
Auslöser des Verfahrens sind zwei Verfassungsbeschwerden Betroffener. Der eine war über mehrere Tage hinweg mit einer Fünf-Punkt-Fixierung ruhiggestellt, so lautet der Fachausdruck für ein Gurtsystem, das beide Arme, beide Beine und den Bauch festzurrt. Dem anderen, schwer alkoholisiert in die Psychiatrie eingeliefert, widerfuhr eine "Ruhigstellung", wie sie nach den Angaben der Fachleute nur in extremen Ausnahmefällen vorkommt: Sieben-Punkt-Fixierung, das heißt: Arme, Beine, Bauch, Brust und Stirn. Quälende acht Stunden lang. "Das ist in jedem Fall unverhältnismäßig", sagte sein Anwalt Rolf Marschner.
Nur in wenigen Bundesländern ist es Pflicht, dass ein Richter die Fixierung anordnet
Angst, Hilflosigkeit, Einsamkeit, Erniedrigung, Wut: Das sind die Gefühle, die einen fixierten Patienten bewegen, sagte Peter Brieger, ärztlicher Direktor im Münchner Isar-Amper-Klinikum. Genaue Zahlen gebe es nicht, aber in der Psychiatrie müssten drei bis acht Prozent der Patienten zeitweise fixiert werden. Ein wachsendes Problemfeld seien psycho-aktive Substanzen wie Crystal Meth: "Die Menschen toben dann derart, dass man sie auch mit drei Pflegern nicht bändigen kann." Auch die Zahl von Asylbewerbern in der Psychiatrie nehme zu. Und schließlich die Fälle von Demenz: alte, verwirrte Menschen, die man fixiert, damit sie nicht stürzen und sich dabei lebensgefährliche Brüche zuziehen.
Nun herrschte im Sitzungssaal des Gerichts an diesem Dienstag kein Dissens darüber, dass man sich kaum einen tieferen Eingriff in Grundrechte vorstellen kann. "Die staatliche Freiheitsentziehung ist die schwerste Form der Freiheitsbeschränkung und ist nur in besonderen Fällen verfassungsrechtlich gerechtfertigt", sagte Gerichtspräsident Andreas Voßkuhle. Immer wieder hat das Gericht geurteilt, dass Zwang gegen Patienten äußerst restriktiv zu handhaben ist. Es ging um Zwangsbehandlung mit Medikamenten, Karlsruhe beanstandete 2011 Gesetze in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg - und mahnte, dass es auch unter den Bedingungen einer geschlossenen Abteilung einen Rest von Freiheit und Selbstbestimmung geben müsse. Zugleich aber schlossen sie Zwangsbehandlungen nicht völlig aus.
Das juristische Fundament ist also gegossen - nur dürfte es gar nicht so leicht sein, darauf aufzubauen. Das zeigte bereits die Diskussion zum Thema Richtervorbehalt. Die rechtsstaatliche Absicherung durch eine vorherige richterliche Genehmigung ist in Deutschland ja ziemlich verbreitet. Dies gilt auch für die zwangsweise Unterbringung in der Psychiatrie. Bei der Fixierung dagegen - also bei der Freiheitsentziehung innerhalb der Freiheitsentziehung - muss der Richter nur in Berlin, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen eingeschaltet werden; demnächst, nach einer soeben beschlossenen Reform, soll das auch in Bayern gelten. Baden-Württemberg indes hat 2014 sogar bewusst darauf verzichtet, einfach deshalb, weil es oft um akute Notsituationen gehe, in denen der Richter ohnehin nur nachträglich zum Zuge käme: "Fixierungen sind im Grunde nicht planbar", sagte der Stuttgarter Sozialminister Manfred Lucha.
Österreich schaffte das "Netzbett" wieder ab, weil es zu sehr an Tierhaltung erinnerte
Noch deutlicher wurde das Dilemma beim Blick auf mögliche Alternativen zur Fixierung - danach hatte der Zweite Senat ausdrücklich gefragt. In Großbritannien etwa werden Patienten so gut wie nie fixiert, wie Peter Lepping schilderte, der dort in einem Zentrum für mentale Gesundheit arbeitet. Randalierende Patienten würden stattdessen von einem speziell trainierten vierköpfigen Notfallteam innerhalb von 30 Sekunden "immobilisiert" - also festgehalten. In 25 bis 50 Prozent der Fälle würden anschließend Medikamente verabreicht, "auch gegen den Willen der Patienten". Das klang für die Ohren der Richter zunächst "ganz charmant", wie Voßkuhle bekannte. Bis Lepping erläuterte, wie mit einem weitertobenden Patienten verfahren wird: Notfalls komme halt die Polizei, nehme ihn mit und sperre ihn in eine Zelle.
Oder die Niederlande: Statt auf Fesseln setzte man dort auf Räume, in denen die Patienten isoliert werden. Das klang nach mehr Bewegungsfreiheit, führte aber zur Zunahme der Isolationsdauer und letztlich zu Protest, wie Tilmann Steinert von den Südwürttembergischen Zentren für Psychiatrie schilderte. Keine ideale Lösung, ebenso wenig wie das "Netzbett" in Österreich. Das hielt man - ebenfalls wegen der größeren Bewegungsfreiheit - eine Zeit lang für eine gute Idee, aber inzwischen ist es verboten. Weil es zu sehr an Tierhaltung erinnert.
Die Verhandlung zeigte: Man wird den bedrückenden Umstand, dass in der geschlossenen Psychiatrie mitunter Zwang notwendig ist, auch mit dem Grundgesetz nicht aus der Welt schaffen können. Trotzdem wurden ein paar verheißungsvolle Ansätze deutlich. Nach den niederländischen Erfahrungen mit der Isolation von Patienten kehrte man dort wieder zu den Wurzeln der Medizin zurück: Man habe verstärkt die Grunderkrankungen behandelt, sagte Lepping. Mit verblüffenden Resultaten: Eine Verdreifachung der Behandlungen habe zu 44 Prozent weniger Zwangsmaßnahmen und 40 Prozent weniger Übergriffen gegen das Personal geführt.
Auch Peter Brieger vom Isar-Amper-Klinikum hat eine Methode erprobt: Die Eins-zu-Eins-Betreuung. Also eine intensive Beschäftigung mit den Patienten, die freilich einen höheren Personaleinsatz erfordert. Womit man wieder beim Zusammenhang von Fixierung und Finanzierung wäre: "Wenn ich genügend Mitarbeiter für die Eins-zu-Eins-Betreuung habe, dann kann ich die Zahl der Fixierungen reduzieren."