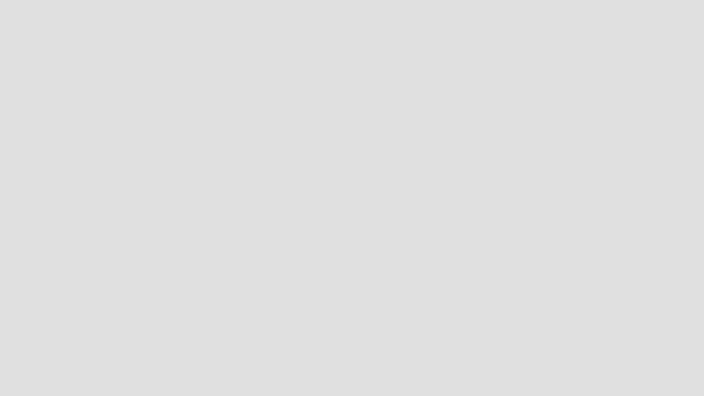Kurz vor Leipzig steht eine Pyramide, 31 Meter hoch. Wenn sie nachts erleuchtet ist und alles andere im Dunkeln liegt, kann man sich einbilden, vor einem liege das Niltal und nicht die A 38 zwischen Knautnaundorf und Gaschwitz. Die Pyramide ist die größte Attraktion im Freizeitpark Belantis und eigentlich eine Wasserrutsche. Sie ist nicht aus Sandstein, sondern aus einem Betonkunststoffgemisch, das schwarz anläuft durch den Dreck der Autobahn. Drei Jahre lang habe ich die Pyramide vorbeifliegen sehen, jeden Freitag, vom Rücksitz irgendeines Autos. Sie ist mir zum Symbol für das Pendeln geworden: die Illusion einer Reise, begleitet von nervenaufreibendem Auf und Ab.
430 Kilometer liegen zwischen München und Leipzig. Dank der neuen ICE-Strecke kann man die inzwischen recht zügig hinter sich bringen. Früher jedoch kostete eine Fahrt mit der schnellsten Verbindung knapp 100 Euro und fünf Stunden. Der Fernbus braucht noch länger und fährt zu ungünstigen Zeiten. Eine Mitfahrgelegenheit erscheint da in jeder Hinsicht lohnender: Man steigt zu Fremden ins Auto, rollt vier Stunden die A 9 hinauf, drückt zum Abschied einen Zwanziger ab und die Hände von Menschen, die keine Fremden mehr sind. Wer selten mitfährt, glaubt, dass es tatsächlich so läuft. Wer öfter mitfährt, erlebt, dass Fahrer schneller einschlafen können als Körperteile. Wer jahrelang dabei ist, kauft ein Eigenheim mit Sanifair-Bons und schreibt seine Mitfahr-Memoiren.
1. Kapitel - Fluchtpunkt Sachsen-Anhalt
Das Rasthaus Frankenwald kurz hinter Hof ist eines von zwei Brückenrestaurants in Deutschland. Man kann hoch oben über der Fahrbahn sitzen und ein Schnitzel genießen, das aussieht wie ein paniertes Elefantenohr. Früher hatte man von dort aus einen guten Blick auf Stacheldraht und Wachtürme. Heute ist nicht mehr viel zu sehen von der innerdeutschen Grenze, aber man spürt sie noch. Das Wetter ändert sich hier manchmal abrupt, und Freitagabend fahren die Autos fast ausschließlich in eine Richtung - gen Osten. Dass dreimal mehr Beschäftigte von den neuen in die alten Bundesländer pendeln als umgekehrt, hat etwas mit Niedriglöhnen zu tun und damit, dass keines der Dax-Unternehmen seinen Sitz in Ostdeutschland hat. Aber auch mit dem, was die Leute Heimat nennen.
E. trug gestreifte Hemden, eine natürliche Bräune und war auf eine Otto-Katalog-hafte Art gut aussehend. Seine Familie verbrachte die meiste Zeit in einem Vorort von Leipzig. E. verbrachte die meiste Zeit in einem Passat, der nach Vanille roch. In seinem Online-Profil stand: "Bitte nicht während der Fahrt essen." E. war ein guter Fahrer und ein noch besserer Angestellter. Er kam als Erster und ging als Letzter, weil niemand zu Hause auf ihn wartete. Er versackte nicht in Bars, er fing nichts mit Kollegen an, keine Affären und schon gar keinen Streit. Er lebte in einer WG, auf acht Quadratmetern, Wand an Wand mit einem Pärchen. Das wiederum stritt sehr oft. E. plauderte darüber, als sei es das Wetter, etwas, das nicht zu ändern ist. Er hätte ganz nach München ziehen können, aber er wollte nicht - zu groß, zu blasiert, zu teuer. Auch nach acht Jahren fremdelte E. mit der Stadt, er pflegte dieses Gefühl wie eine stachlige Zimmerpflanze. Es half ihm dabei, sich jede Woche aufs Neue in die Staus vor Ingolstadt und Nürnberg zu stellen.
18 Millionen Deutsche sind Pendler. Das heißt, sie überwinden auf dem Weg zur Arbeit Grenzen - die von Gemeinden, Bundesländern und die eigenen. Zwei Drittel nutzen das Auto. Immer häufiger holen sie sich ihr Spritgeld zurück, indem sie Leidensgenossen mitnehmen. Bei manchen dieser Kilometerfresser stieg ich mehrmals zu, die meisten aber waren One-Way-Stands: Da war der Biologe, der in München unter der Woche den Fortpflanzungszyklus der Wühlmäuse erforschte und am Wochenende in Merseburg versuchte, mit seiner Freundin ein Kind zu zeugen. Es gab D., der immer freitags in einem schwarzen Mustang nach Dessau heizte, wo er auf seine Frau wartete, die von Hessen aus einpendelte. Oder K., die Fernsehfrau, die in ihrem roten Van so viele Jahre hin und her gefahren war, dass sie praktisch die Erde zwanzig Mal umrundet hatte.
Am liebsten war mir der stille Ronny. Ronny war Fliesenleger, so viel war aus ihm rauszubekommen. Er hätte sich auch in Leipzig die Knie kaputt machen können, aber in München bekam er das Doppelte dafür und einen Dienstwagen. Er musste Kinder haben, weil an den Fenstern seines Golfs ein Marienkäfer-Sonnenschutz hing. Ronny war bis zum Kinn tätowiert. Man musste also nicht viel reden, um zu wissen, was ihm unter die Haut ging: Werder Bremen und Hardcore-Punk. Trotzdem hörte Ronny im Auto ausschließlich Deutschlandfunk, was mich stets mit stummer Dankbarkeit erfüllte. Die meisten Menschen bevorzugen ihre Lieblingsmusik. Ich kenne inzwischen die Techno-Sets von Dr. Makrele und die Alkoholballaden einer Mittelalterkapelle namens Knasterbart ("Branntwein für alle!"). Der kleinste gemeinste Nenner aber bleibt das Privatradio. Nach einer Stunde stumpfer Bieber-Beats kriegt man Kopfweh. Nach zwei Stunden verliert die Vorstellung eines tödlichen Unfalls ihren Schrecken. Nach drei Stunden ist man eine Person, die immer lacht, die immer lacht, die immer lacht.
Der stille Ronny mochte Radiofeatures mit Titeln wie: "Können Vasen sprechen? Eine Archäologie der Geräusche". Er war ein Zen-Meister der Mitfahrgelegenheit, der Einzige, bei dem ich lange regelmäßig mitfuhr und deshalb auch der Einzige in diesem Text, der einen Namen hat. Der Tag, an dem Ronny nicht mehr inserierte, war ein schlechter Tag, aber wohl nur für mich. Ich sah ihn ein paar Monate später in Leipzig auf der anderen Straßenseite. Er trug eine Handwerkerhose und ein kleines Mädchen auf dem Arm.
2. Kapitel - The Fast and the Fearful
2. Kapitel - The Fast and the Fearful
In den Autos Fremder lauert der Tod! Einen Gedanken zu ignorieren, den einst besorgte Eltern ins kindliche Bewusstsein pflanzten, ist nicht so einfach. Jede Mitfahrgelegenheit ist ein Ringen mit der eigenen Paranoia: Jemand, der eine Wolldecke über der Rückbank ausbreitet, hat nur einen haarenden Hund - oder Blutflecken auf den Polstern. Ein Fahrer, der schwarze Handschuhe trägt, möchte nur das Lenkradleder schützen - oder keine Fingerabdrücke hinterlassen.
Tatsächlich trifft man auf diesen Fahrten seltsame Männer. Einer schnitt gern Blutwurst in Scheiben und toastete sie. Ein anderer schrie ständig sein Telefon an: "Siri! Leck mich am Arsch!" Darauf Siri: "Ich hoffe, wir können Freunde bleiben." Es gibt Typen, die schütteln die Hand bei der Begrüßung etwas zu lange. Andere treten das Gaspedal durch und schauen dabei nicht auf die Straße, sondern auf den Beifahrersitz. Einige fragen "Wo wohnst du eigentlich?" und murmeln dann: "Das merk ich mir." Die meisten dieser Männer sind sich sicher zu flirten. Aus diesem Grund gibt es "Ladies only"-Fahrten, aber die sind rar und entsprechend schnell ausgebucht. Bleibt nur das Bewertungssystem, um abzuschätzen, ob ein Fahrer Chauffeur oder Chauvi ist, und manchmal nicht mal das.
Einmal musste ich kurz entschlossen nach München zurück. Der letzte Zug war weg und online nur noch eine passende Mitfahrgelegenheit zu finden: Der Fahrer hatte weder Lob noch Tadel von anderen erhalten, keine Details zu sich oder der Fahrt angegeben. Ich buchte trotzdem. R. trug einen Pullover mit Zopfmuster und eine randlose Brille. Sein Gesicht war so ausdruckslos wie die Silhouette in seinem fotolosen Profil. Er kündigte nur einen weiteren Mitfahrer an, der sei mal eben pinkeln. Fünf Minuten später kam ein Riese um die Ecke, zwei Meter groß. In seiner glänzenden Lederjacke und den hohen Stiefeln sah er aus wie einer der Liquidatoren, die in Tschernobyl radioaktiven Schutt geschaufelt hatten. D. stellte ihn als seinen Cousin vor und hielt die Autotür auf. Ich stieg ein.
Ich werde das leise Klack nicht vergessen, mit dem die Türen verriegelten, gefolgt von der sägenden Erkenntnis, gegen Bauch und Kopf gehandelt zu haben, gewissermaßen selbst schuld zu sein an allem, was nun kommen möge. D. drehte sich um, sein Lächeln war das der Grinsekatze aus Alice im Wunderland, es hing da im Nichts und formte die Worte: "Ich hätte ja Angst, so als Frau allein." Ich sah mich selbst, verscharrt unter feuchtem Herbstlaub, vielleicht hinter dem Gasthof Lederhose, wo "Satansteak" auf der Karte steht und die Trucker manchmal Schrotkügelchen ausspucken, weil im Thüringer Hinterland noch selbst gejagt wird. Ich schwor mir, eine Bahncard 100 zu kaufen, sollte ich das hier überleben, ach was, nach München zu ziehen und nur noch Dirndl zu tragen. Dann sagte niemand mehr ein Wort. Ab und zu hielt R. seinem Cousin das Handy hin. Darauf waren Frauen zu sehen. Der Cousin schüttelte entweder den Kopf oder nickte. Irgendwann fragte R., ob er mich bis vor die Haustür fahren solle. Ich ließ mich an der Münchner Freiheit rauswerfen und lief den Rest zu Fuß. Eine Woche später saß ich wieder im Auto.
3. Kapitel - Fury Road
3. Kapitel - Fury Road
M. klemmte neben mir auf der Rückbank und redete wie vorgespult. Ein schmaler Mann, der sich an jeder Raststätte eine Kippe drehte und sie mit einem Zug zu Asche rauchte. Während der Fahrt hatte er die Hände um die Kopfstütze unseres Fahrers geklammert, als wolle er selbst das Lenkrad halten. Seine Jacke behielt er die ganze Zeit an. M. fragte jeden im Auto nach seinem Lieblingssong, wollte nach Leipzig, um seine Freundin zu besuchen. M. mochte ältere Frauen. "Die kochen besser und zahlen ihre Klamotten selbst", sagte er und machte ein Geräusch, wie jemand, der ein Pony mit einem Zuckerstückchen lockt. M.s Eltern waren in den Neunzigern vor dem Krieg in Kroatien nach Deutschland geflohen. Die Familie war erst im Westen, dann im Osten Deutschlands untergekommen. In Freiburg hatte M. zum ersten Mal eine Schule besucht. Ein Nachbar habe ihm damals Nachhilfe in Deutsch gegeben, erzählte er, ein grauer Herr, streng, aber geduldig. Der Mann habe ihm Bücher mit alter Schrift gezeigt und irgendwann seine Wehrmachtsuniform. "Der Nazi hat mir das Lesen beigebracht", gluckste M. und verschluckte fast seinen Kaugummi.
Schwer zu sagen, ob das so stimmt. Jeder, der wöchentlich zu Fremden ins Auto steigt, hat ein Arsenal an Geschichten. Man erzählt sie, wenn das Schweigen dröhnt oder dem Fahrer die Lider flattern. Man passt sie den Bedürfnissen des Zuhörers an, poliert sie, wie ein teures Glas. Am Ende ist nicht so wichtig, ob sie wahr sind, gut genug müssen sie sein.
Nun war M. eher der Typ, der aussprach, was ihm gerade durch den Kopf ging. Als kurz vor Leipzig die leuchtende Pyramide im Rückspiegel verschwand, fing er an, sich im Gurt zu winden: "Da hab ich mal gewohnt!" Er deutete aus dem Fenster, wo nur Dunkelheit war und in der Ferne der Schein von Straßenlaternen. "In den Neunzigern haben die hier einen kaltgemacht!", rief M., ohne dass die Begeisterung aus seiner Stimme wich.
Was stimmt, ist dies: Am Abend des 4. Juli 1998 verprügelten jugendliche Neonazis in Gaschwitz bei Leipzig den portugiesischen Zimmermann Nuno Lourenço. Er war wegen eines Montage-Auftrags nach Deutschland gekommen und auf dem Weg zu einer Telefonzelle. Die Männer griffen ihn mit Eisenketten an, schlugen Lourenço und schnürten ihm die Kehle zu, bis er am Boden lag. Einer trat mehrmals mit Stahlkappenstiefeln gegen seinen Kopf. Ein halbes Jahr später starb Nuno Lourenço in Portugal an den Folgen seiner Verletzungen. Der Haupttäter bekam vier Jahre Gefängnis, der Rest Bewährungsstrafen.
"Deutschland hat verloren", hatte M. im Auto gesagt, und eine Zeit lang war ich überzeugt, er meinte den Zustand des Landes, in dem so etwas Schreckliches geschehen kann. Bis mir einfiel, dass am 4. Juli 1998 noch etwas anderes passiert war: Die deutsche Mannschaft hatte bei der Fußballweltmeisterschaft in Frankreich drei Tore gegen Kroatien kassiert und war im Viertelfinale ausgeschieden.
Die Fahrt Schulter an Schulter mit M. war eine meiner letzten. Der ICE von München nach Leipzig braucht nur noch drei Stunden und 15 Minuten. Man kann pinkeln, wann man will, und essen, was man will. Meine erste Fahrt auf der neuen Strecke fühlte sich an, als würde der Zug das Land falten. Sie verlief völlig ereignislos.