Öde und breit strömt die Elz durch die südbadische Ebene dem Rhein zu. Aber weiter oben, im Schwarzwald, ist sie wild. Man kann an ihrem Ufer entlangwandern, am besten "nabzus", wie man in Baden sagt, abwärts also. Man kann aber auch da stehen bleiben, wo sich unter Steinen und Wurzeln das Wasser sammelt und beruhigt, und die Angel auswerfen und wieder einziehen, bis eine der Bachforellen anbeißt und an der Schnur aufsteigt und sich windet, ein Kampf um Leben und Tod.
Ernest Hemingway tat beides. Er wanderte, er angelte. Und er schrieb darüber im Ton des gut gelaunten jungen Mannes, der seiner Heimat die Welt erklärte. Seit 1921 war der spätere Nobelpreisträger für den Toronto Star Weekly und den Daily Star in Europa unterwegs, frisch verheiratet und frei. Er berichtete über die Weltwirtschaftskonferenz in Genua und die Friedenskonferenz in Lausanne, über den griechisch-türkischen Krieg und natürlich über Stierkämpfe und das Paris der Zwanzigerjahre. Zwischendurch zog es ihn in die Natur, ans Meer, in die Berge und an die Flüsse, zum Fliegenfischen.
Zum Angeln brach er im August 1922, gerade 23 Jahre alt, mit Ehefrau Hadley und einem befreundeten Paar nach Triberg auf, das in einer Annonce im Baedeker 1921 damit warb, "weltbekannter Höhenluftkurort" zu sein, "700-1000m üb. d. Meere, Herz des mittleren Schwarzwaldes und Glanzpunkt der großartigen badischen Schwarzwaldbahn".
Die Reise war ziemlich beschwerlich. Fünf Stunden sei man von Freiburg nach Triberg unterwegs gewesen, behauptet Hemingway in einer von mehreren Reportagen ("Angelparadies Baden"), vier davon stehend, "während dicke und unglückliche Deutsche und ihre dicken und gelockten Frauen sich immer wieder. . . an uns vorbeidrängelten." Auch der Schwarzwald enttäuschte die Gäste aus den Vereinigten Staaten: Er sei gar kein Wald, "sondern bloß eine Menge bewaldeter Hügel und hochkultivierter Täler". Und Triberg? Der Luftkurort, in dem sogar Napoleon abgestiegen war? "Triberg besteht aus einer einzigen, von steilen Hotels gesäumten steilen Straße."
Das ist natürlich übertrieben. Aber auch nicht falsch. Triberg liegt in einem Talkessel. Weite Sicht hat man hier nicht. Noch immer zieht sich die Hauptverkehrsstraße viel zu steil den Berg hinauf.
Vor über hundert Jahren mag Triberg einmal einer der am häufigsten besuchten Höhenkurorte im Schwarzwald gewesen sein. Heute muss man "zugucken, wie alles den Bach nabgeht". Raymond Wiedel, der das sagt, ist Triberger und sehr heimatkundig. Er erinnert sich gern an die guten Zeiten, als sein Großvater eine Manufaktur unterhielt, in der sechs Uhrmacher über feine Mechanik gebeugt saßen. Er weiß von drei florierenden Brauereien, kann von grazilen, elektrischen Straßenlaternen erzählen und von einer Baumallee auf dem Marktplatz, wo heute Autos parken. "Die großherzogliche Familie war jedes Jahr da." Es gab Eishockeyturniere und den ersten elektrisch angetriebenen Ski- und Rodellift der Welt.
Aber jetzt? Jetzt kommt man beim Zählen der geschlossenen Wirtschaften und Ladenlokale an der Hauptstraße gar nicht mehr nach. "Kraftomnibusse", wie sie der alte Baedeker nennt, kutschieren zwar immer noch viele nach Triberg. Aber genau das ist ja das Problem. "Die Kundschaft", sagt Wolfgang Abel, Gastrokritiker und Schwarzwaldkenner, "kommt mit Bussen, man dreht eine Runde, guckt sich den Wasserfall an - und steigt wieder ein. Triberg hat ganz auf Kuckucksuhren, Souvenirs und Wasserfall gesetzt, das musste schiefgehen."
Ein wenig mondän ist es zum Glück noch immer im Hotel Wehrle, wo Ernest Hemingway ein paar Nächte verbrachte. Es hat sich den Seidentapetencharme früherer Zeiten bewahrt. Auch das Zimmer des Ehepaars Hemingway hält man bereit, ganz original so, wie es damals war: schmuck lackiertes Holz und ein schöner Blick den Hang hinauf zu den berühmten Wasserfällen.
Hemingway muss gesehen und gehört haben, wie sich dort oben die Gutach über sieben Fallstufen 160 Meter tief in den Abgrund stürzt. Sogar elektrisch illuminiert wurde das Spektakel bei Nacht. Aber er verlor kein Wort darüber. Es sind die anderen Geschichten, die ihn interessieren. Zum Beispiel was es heißt, angeln zu wollen, aber nicht angeln zu dürfen, weil die Bürokratie im Nachkriegsdeutschland genauso schlimm ist, wie man erwartet. Er hatte bereits ein Stück Bach gepachtet, verbrachte aber dennoch zwei Tage auf dem Amt mit der Bitte um "das fischenkarten", die Angelerlaubnis, vergeblich. In nahegelegenen Nussbach traf man schließlich auf einen Bürgermeister, der die Sache mit der Fischenkarte nicht so genau nahm (oder die Amerikaner schlicht nicht verstand).
Auch heute stehen Bußgelder und sogar eine zweijährige Freiheitsstrafe auf die sogenannte Fischwilderei. Erlaubnisscheine bekommt man bei den örtlichen Angelvereinen - sofern man eine qualifizierende Angelprüfung abgelegt hat. Die allerdings besteht, erzählt Uwe Straky, der Vorsitzende des Angelvereins Oberes Elztal, aus 833 Fragen. Die Frage nach der Flügelstellung einer Steinfliege im ruhenden Zustand etwa hätte Hemingway bestimmt gefallen.
Straky ist nicht nur Angler, er ist auch Psychotherapeut und weiß, dass Angeln mit "Selbstwirksamkeit" zu tun hat und mit der narzisstischen Freude an der Macht über Leben und Tod. Aber er angelt lieber, als hochgestochen darüber zu reden. Am liebsten in der Elz, frühmorgens um sechs, wenn der Tau noch in den Wiesen hängt und sich ein sonniger Tag ankündigt in Oberprechtal - jenem Dorf, zu dem Hemingway mit Frau und Freunden von Triberg aus aufbrach, um durch den gar nicht schwarzen Black Forest zu wandern.
Auf dem Weg fand sich auch ein ideales Angelplätzchen. Während Mrs. Hemingway unterm Baum saß und nach möglichen Gefahren spähte - man besaß ja weder einen Angelschein, noch hatte man den Bach gepachtet - warf ihr Mann die Fliegenangel aus. Hemingway fing vier Fische, jeder wog, wie er behauptete, fast ein dreiviertel Pfund.
Schon möglich, meint Straky. Bachforellen waren damals zahlreicher, größer und fetter als heute. Denn sie mögen Schmutz, Fäkalien, Abwässer, eben alles, was man jahrhundertelang bedenkenlos in die Bäche kippte. Inzwischen ist der Umweltschutz besser, das Wasser nährstoffarmer und das Leben für Forellen unwirtlicher geworden. Einen starken Feind haben sie noch dazu: den Fischreiher, der überall in den Feldern steht.
Angelt Straky in der Elz, kehrt er häufig ohne Fang zurück. Manchmal zieht er einen Fisch raus und gibt ihn wieder frei, weil das Tier die vorgeschriebene Mindestgröße von 27 Zentimetern nicht erreicht. Im Frühling setzen er und seine Kollegen vom Angelverein Zehntausende frisch geschlüpfte Forellen in den Bach. Es überleben nur ein paar Prozent. Trotzdem. Man muss sich um die Schwarzwaldforelle bemühen. Es gibt sie nicht mehr oft.
Wenn man einen dicken Fisch an der Angel habe, sagt Straky bei einer Tasse Kaffee im Rössle in Oberprechtal, gehe der Puls hoch, das Adrenalin steige an. "Das ist Lebensfreude pur!" An drei Wänden wird im Rössle des berühmten Dichters gedacht, den man auf der Homepage "Hemmingway" nennt. Vielleicht ein Versehen. Aber auch einen winzigen Racheakt würde man den Wirtsleuten nachsehen, schließlich hat Hemingway nicht nur den Gasthof, sondern auch Großtante und Großonkel mütterlicherseits beleidigt.
Die Bauern vertrieben die Amerikaner, weil die ihnen das Gras zertrampelt hatten
Das Rössle, schrieb er, sei zwar weiß getüncht und sähe von außen sauber aus, sei innen aber dreckig. "Die Betttücher sind kurz, die Federbetten klumpig, die Matratze ist hellrot, das Bier ist gut, der Wein ist schlecht." Es servierte der Besitzer, schrieb Hemingway, der "stur wie ein Ochse aussah und manchmal mit einem Teller Suppe in der Hand stehen blieb, um leer aus dem Fenster zu starren". Seine Frau dagegen hätte ein "Gesicht wie ein Kamel".
Immerhin: Man aß gut, Kalb, Kartoffeln, Kopfsalat und Apfelkuchen. Aber war das wirklich Kalb?
Wolfgang Abel ist nicht überzeugt. Eher schon könnte es sich um Rind gehandelt haben. Und eigentlich regierte im Schwarzwald "eine Wurschtküche mit Schlachtplatte, Blut und Leberwurst und Kartoffeln. Die Forellen gab es nur für bessere Gäste." Der schlechte Wein, über den Ernest Hemingway klagte, das werde wohl Most gewesen sein.
Die Unfreundlichkeit der Wirte aber: Das könne stimmen, nicht nur des gerade vergangenen Krieges wegen. "Die Schwarzwälder sind verschlossen und wortkarg, wie alle, die aus einer ländlich-bäuerlichen Kultur kommen", erklärt Abel. Das sei zwar "schon ein bissel herber". Aber so negativ nun auch wieder nicht. Es werde doch heute manchmal zu viel geredet in der Gastronomie, in dieser aufgesetzten, amerikanischen Art. "Was will'sch?" "War's recht?" - das genüge doch eigentlich vollkommen!
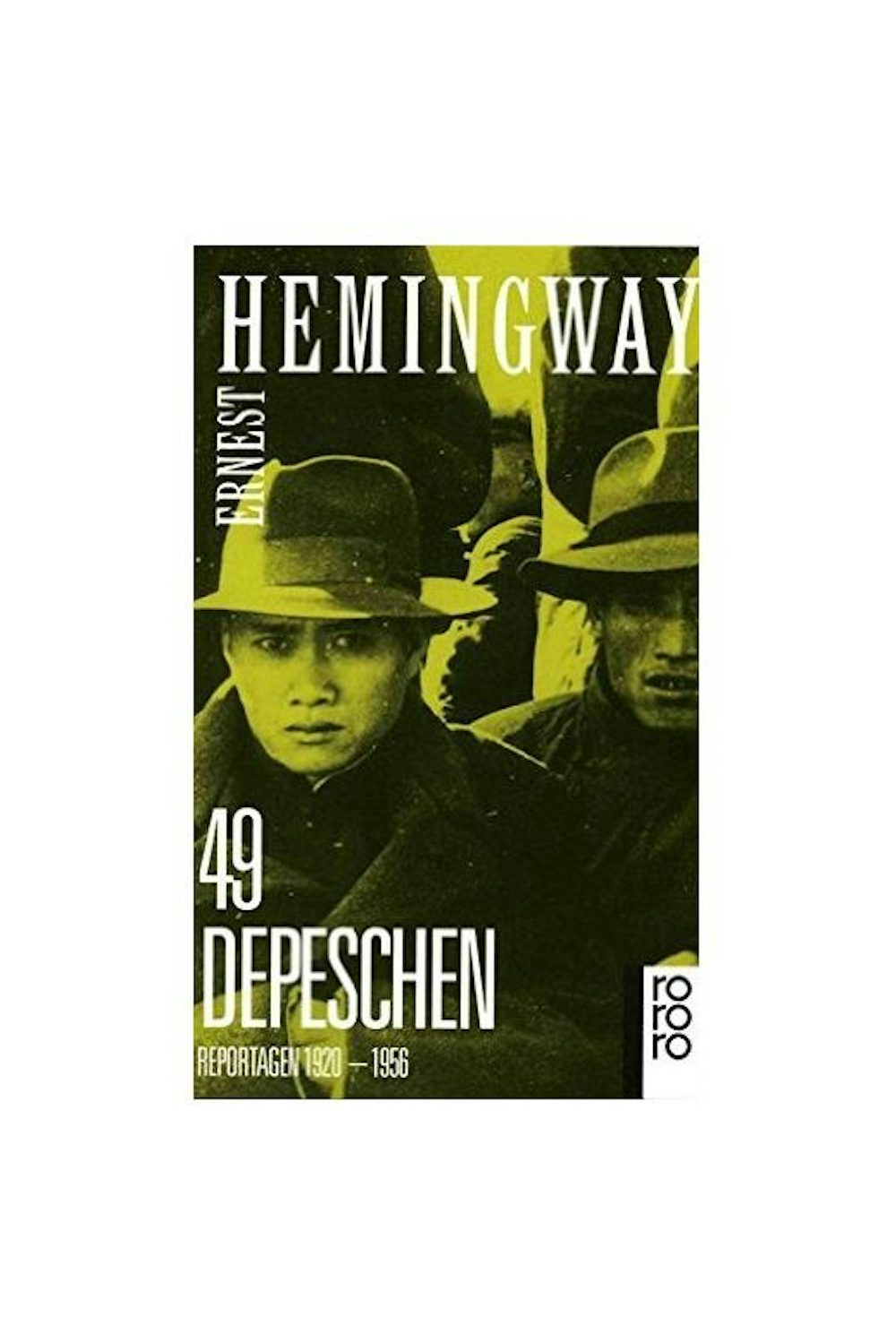
Man kann sich das Aufeinandertreffen vorstellen: hier die hochgestimmte, redselige, immer etwas angetrunkene Reisegruppe aus der amerikanischen Großstadt, die Geld wie Heu hatte, weil der Dollar so gut stand in der Zeit der deutschen Inflation. Dort die immer schon armen Bauern, die, wie Hemingway erzählt, den jungen Touristen mit der Mistgabel hinterherliefen, weil sie unerlaubt in der Elz angeln wollten. Aber vielleicht war es gar nicht das Angeln, das die Einheimischen provozierte. Vermutlich, sagt Abel, vertrieben die Bauern die Gruppe, weil sie ihr Gras zertrampelte. Das sei immer noch ein Problem. "Nach einem schönen Wochenende sind plötzlich lauter Löcher in der Wiese, weil sich die Städter ins Gras gelegt haben. Klar, dass da der Landwirt, der nicht mähen kann, einen dicken Hals kriegt."
Viel später, in der Erzählung "Schnee am Kilimandscharo" von 1952, wird Hemingway noch einmal in den Schwarzwald zurückkehren. Sein tödlich verwundeter Held erinnert sich dort an all die Geschichten, die er nicht erzählt hat und noch erzählen könnte. Er beschreibt zwei Wege, die von Triberg nach Nussbach führten. Einen die Straße entlang, durchs Tal, einen hoch über Hügel und Wiesen, hinab zur Brücke. "Es gab Birken entlang des Flusses, der nicht groß, sondern schmal war, klar und schnell, mit Vertiefungen, die sich unter den Wurzeln der Birken gebildet hatten."
Dann erzählt er vom Wirt des Hotels Wehrle in Triberg. "Der Besitzer hatte eine gute Saison. Es war sehr angenehm und wir waren alle gute Freunde. Das nächste Jahr kam die Inflation und das Geld, das er im Vorjahr verdient hatte, war nicht genug, um das Hotel zu eröffnen, und er hängte sich auf."