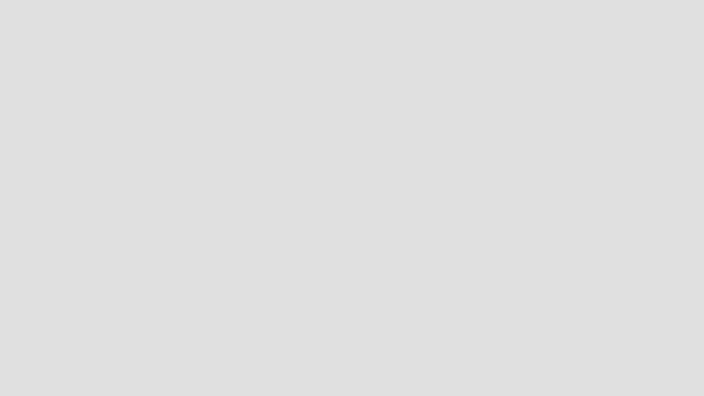Am Samstag wird in Hunderten Städten in den USA ein March for Our Lives stattfinden, ein Marsch für unser Leben. #NeverAgain, ein Zusammenschluss von Überlebenden des Massakers in der Schule in Parkland, Florida, hat zu dieser Verteidigung des nackten Lebens aufgerufen. Mit dem Marsch wollen die Organisatoren und Protestierenden dem Wahnsinn der so gut wie freien Verfügbarkeit halb automatischer Waffen ein Ende setzen.
Die Teenager - denn vor allem Jugendliche haben ihre Stimmen erhoben - mussten sich von der Waffenlobby viel anhören. Sie seien bei ihren Auftritten manipuliert worden, heißt es, oder sie seien gar trainierte Schauspieler. Ein Argument darf nie fehlen: Wer Waffenbesitz rigoros beschränken will, entlarve sich als Verfassungsfeind. Denn stehe in der Verfassung nicht klipp und klar, dass jeder Bürger Waffen tragen dürfe?
Das stimmt zwar nicht, aber dass es fast alle Amerikaner glauben, hat nicht nur mit der Macht der National Rifle Association (NRA) zu tun, sondern auch mit Juristen, zum Teil sogar linksliberalen Rechtswissenschaftlern, die das Verfassungsverständnis im vergangenen Vierteljahrhundert grundlegend verändert haben.
1791 wurde die Bill of Rights angenommen. Sie umfasste die ersten zehn Zusätze zur Verfassung, und sollte vor allem jene Amerikaner zufriedenstellen, die fürchteten, der neue Bundesstaat könne die Bürger ohne spezifische Rechtsgarantien unterdrücken. Der zweite Verfassungszusatz - jener über den Waffenbesitz - blieb daraufhin aber fast zwei Jahrhunderte lang ein Stiefkind der amerikanischen Juristen. Nur über ein anderes Amendment wurde noch weniger geschrieben, nämlich das dritte, welche es der Bundesregierung verbietet, Soldaten in Privathäusern ohne Erlaubnis der Besitzer einzuquartieren.
Sprachlich war der Zusatz ein Graus: eine fast lateinische Konstruktion, wilde Kommata
Es galt als ausgemacht, dass es sich beim Zweiten Verfassungszusatz nicht um ein individuelles Recht auf Waffenbesitz handelte, sondern um das Recht des Kongresses und der Bundesstaaten, streng regulierte Milizen aufzustellen. Die im Original geradezu lateinisch anmutende Konstruktion mit abenteuerlich gesetzten Kommata schien diese Lesart zu bestätigen: "A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed."
In den Achtzigerjahren aber wurden einige Juristen plötzlich kreativ. Der in Texas lehrende Sandy Levinson bezeichnete den zweiten Verfassungszusatz als eine Art "peinlichen Verwandten". Natürlich, so Levinson, sei man als Linker gegen den uneingeschränkten Waffenbesitz - aber irgendwie sei der Artikel doch auch "interessant". Bekanntermaßen hatte man aus anderen Passagen der Bill of Rights im 20. Jahrhundert viel für progressive Anliegen herausgeholt, man denke nur an das Recht auf Abtreibung. Nur: Was war bei einem Absatz über Milizen schon zu holen?
Levinson und einige weitere Juristen führten den zweiten Verfassungszusatz in die engagiert geführte Debatte über "Republikanismus versus Liberalismus" ein. Republikaner waren dabei nicht die Anhänger der großen rechten Partei, sondern die Vertreter eines Ideals von tugendhaftem kollektiven Engagement für das Gemeinwohl. Ihnen gegenüber stand der liberale Bourgeois, der nach seinem vor allem materiellen Glück im Privaten strebt.
Newt Gingrich wollte den Waffenbesitz zum Menschenrecht erklären lassen
Auf einmal war es relevant, dass in der römischen Republik der "civis" auch "miles" war, der Bürger auch Soldat, und dass sich Machiavelli zeitlebens für eine Bürgerwehr zum Schutz der Freiheit seines geliebten Florenz eingesetzt hatte. Levinson und seine Mitstreiter scheuten auch vor gewagten Vergleichen mit der Alten Welt nicht zurück: Die Europäer, so ihre Argumentation, haben mehr Vertrauen in den Staat und seien eigentlich alle Weberianer, also fügsam gegenüber Max Webers Verständnis des Staates als Monopolisten legitimer Gewaltanwendung. Die Amerikaner hingegen seien eher wehrhafte Demokraten mit der Waffe in der Hand im Kampf gegen einen tyrannischen Staat.
Nun bestand aber die Gefahr darin, dass sich mit diesen Argumenten die rechten Milizen rechtfertigen ließen, die in den Neunzigerjahren immer aggressiver wurden (mancher wird sich noch an die Michigan Militia erinnern). Bevor es mit einer Art individuellem Recht auf Widerstand gegen die Staatsgewalt ernst werden konnte, bogen die Juristen denn auch in letzter Sekunde auf abenteuerliche Weise in eine ganz andere Richtung ab. Das Second Amendment, so hieß es nun, rechtfertige eine allgemein republikanische Politik: Man müsse mehr Umverteilung betreiben, da schon die Klassiker der republikanischen Theorie vor zu großen Unterschieden zwischen, mit Machiavellis Worten, "grandi" und "popolo" warnten. Und man müsse die Idee des Dienstes am Gemeinwohl stärken, ohne dass man diesen "Dienst" freilich konkretisieren konnte.
Gleichzeitig wurden andere Stimmen laut, die aus Bruchstücken der Verfassungsdebatten am Ende des 18. Jahrhunderts ein individuelles Recht auf Waffenbesitz abzuleiten versuchten. Da traf es sich gut, dass der inzwischen verstorbene Antonin Scalia, ein vehementer Verfechter des "Originalism", auf der Richterbank des Supreme Court saß. Die "Originalists" vertraten die Ansicht, dass die korrekte Verfassungsinterpretation darin bestehe, die ursprünglichen Intentionen der Gründerväter freizulegen - wozu es vor allem Geschichtskenntnisse braucht, nicht zuletzt über Sprachgewohnheiten im 18. Jahrhundert.
2008 hatte der Oberste Gerichtshof darüber zu entscheiden, ob Washington DC, eine der globalen Hauptstädte der Gewalt, Handfeuerwaffen verbieten dürfe. Zum ersten Mal äußerte sich das Gericht direkt zu der Frage, ob sich aus dem Second Amendment ein Recht auf individuellen Waffenbesitz ergebe - und es war Scalia, der diese Frage enthusiastisch bejahte. Linguistik- und Anglistik-Professoren hatten dem Gericht zuvor eindrücklich zu erklären versucht, warum sich im englischen Sprachgebrauch des 18. Jahrhunderts die Formulierung "A well-regulated militia" nicht vom Rest des Satzes und einem militärischen Gesamtzusammenhang trennen ließe.
Scalia nun nahm genau diese Trennung vor. Er argumentierte, der Verweis auf die Miliz sei nur eine Art Prolog. Die Gründerväter hätten eindeutig gewollt, dass Familien Waffen besitzen, um ihr Heim in "Konfrontationen" zu schützen - obwohl im Verfassungstext weder von Familien noch von Haus und Herd als eine Art bewaffnetem Homeland noch von irgendwelchen Konfrontationen die Rede ist.
Kritiker warfen Scalia denn auch vor, seine eigenen hermeneutischen Grundsätze mit einer Reihe von "philologischen Coups d'Etat" spektakulär verraten zu haben. Doch vielleicht musste er sie auch verraten, um nicht bei der absurden Schlussfolgerung zu landen, dass Miliz-Bürger auch Panzer in der Garage haben sollten.
Charlton Heston behauptete, Waffen verliehen ein Höchstmaß an menschlicher Würde
Scalias Vorgänger Warren Burger hatte die Idee eines verfassungsmäßig garantierten Rechtes auf Waffenbesitz einmal als Betrug am amerikanischen Volk durch eine Interessen-Lobby bezeichnet. Wahrscheinlich ist dieser Betrug immer noch so erfolgreich, weil er sich mit wohlklingenden Werten aufputzen und zu immer neuen Höhen treiben lässt. Der Schauspieler Charlton Heston behauptete einmal mit bebender Stimme, die Waffe verleihe ein Maximum an menschlicher Würde und garantiere außergewöhnliche Freiheit für gewöhnliche Menschen. Und der ehemalige Sprecher des Repräsentantenhauses, Newt Gingrich, versprach, er werde sich bei den Vereinten Nationen dafür einsetzen, dass der individuelle Waffenbesitz in die Menschenrechtscharta aufgenommen werde.
In ihrem aggressiven Auftreten nach dem Massaker in Parkland haben die Vertreter der NRA sich mit juristischen Argumenten eher zurückgehalten. Stattdessen gaben sich die Waffenlobbyisten kulturkämpferisch: Wer gegen die NRA argumentiere, sei ein "europäischer Sozialist", in diesem Lande hätten immer noch "wir, das Volk" das Sagen. In dieser populistischen Vorstellungswelt sind einzig die Mitglieder der "gun culture", der Kultur des Waffenbesitzes, die wahren Amerikaner. Dabei ist die Situation ohnehin polarisiert. Donald Trump, damals Präsidentschaftskandidat, hatte einst an die "second amendment people" appelliert, gegen Hillary Clinton als eine Art letzter Widerstand anzutreten. Zum Glück waren diese ihm nicht gefolgt.
Jan-Werner Müller lehrt Politische Theorie und Ideengeschichte in Princeton. Zuletzt erschien von ihm das Buch "Was ist Populismus?" (Suhrkamp Verlag).