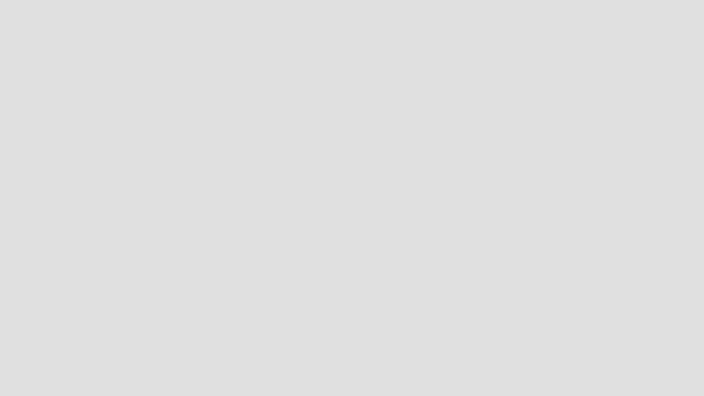Vom Hass ist gerade viel die Rede. Empörung und Erregung, Niedertracht und üble Nachrede nähren das Geschäftsmodell der digitalen Kommunikation, oder auch umgekehrt, dieses kitzelt jene erst hervor. Viele lassen sich verführen, ihre mieseste Seite nach außen zu kehren, weil sie die Opfer, die sie mit Schmutz bewerfen, nicht als Menschen vor sich haben; und diese Mechanismen scheinen ein Teil der populistischen Erfolgsformel zu sein, eine Mischung aus Feigheit und Hochmut, aus Aggression und Empfindlichkeit.
Also werden gegen den Hass und gegen die Hassrede lauter Bücher, Friedenspreise, Demos, Satiren, Appelle, Argumente, Löschtrupps und sogar Gesetze in Bewegung gesetzt. Das ist ja auch recht so, selbst wenn über die Wirksamkeit solcher Gegenwehr im sogenannten liberalen Mainstream gestritten wird. Aber ein wichtiges Genre öffentlicher Verständigung geht dabei allzu sehr unter: die Lobrede. Warum nicht mal zur Abwechslung ein wenig sprachlichen Aufwand betreiben, um zu zelebrieren, was gut ist und gefällt?
Denn auch das Loben will geübt sein. Während in der Erziehung schon vor einer schädlichen Überdosierung des Lobs durch wohlmeinende Eltern gewarnt wird, verkümmert es offenbar in der Erwachsenenwelt. Das möchte der Schweizer Kritiker, Romanist und Publizist Iso Camartin gerne ändern. Sein Buch "Die Kunst des Lobens" enthält eine Sammlung eigener Lobreden sowie einen ermunternden einleitenden Essay über die Bedeutung und Gestaltung dieses Genres. Das Buch, wie üblich im Verlag der "Anderen Bibliothek" bibliophil edel ausgestattet, ist passend zum Thema in ein rotes Fest-Ornat gekleidet, mit eingewobenem Goldglitzer.
"Das Wort Schmeichelei klingt hässlicher, als es die Sache selbst ist"
Das ist überaus schön! Aber die Lobrede steht unter dem Verdacht, diejenige Form der Ansprache zu sein, wo am wenigsten passiert. In der klassischen, von Aristoteles kanonisierten Dreiteilung der Redeformen stehen ihr die Gerichtsrede und die beratende, also die Parlamentsrede gegenüber - und da geht es schließlich immer um etwas, um Mord und Totschlag oder Krieg und Frieden; oder, im Alltag auch mal eine Nummer kleiner, wenigstens um Diebstahl oder ein neues Urheberrecht. Und die Rede des Rechtsanwalts oder der Abgeordneten, so jedenfalls die Hoffnung, kann den Ausgang der Versammlung tatsächlich beeinflussen, also den Beschluss, auf den sie hinausläuft.
Lobreden hingegen wurden seit alters auf Götter und Herrscher geschwungen. Sie sollten bei diesen kein Urteil, kein Gesetz erzwingen, sondern Gunst durch Ehrerbietung. Einer der wirkungsvollsten Einstiegssätze in Iso Camartins eigenen Reden (zum Lob des Soziologen Wolf Lepenies) lautet zwar: "Das Wort Schmeichelei klingt hässlicher, als es die Sache selbst ist." Denn ohne glaubhafte eigene Begeisterung gehe es überhaupt nicht: "Eine Lobrede, die nicht von dieser Überzeugung durchwärmt ist", so Camartin, "erkaltet rasch beim zuhörenden Publikum."
Das stimmt, und doch bleibt der Ruf, dass solchen Reden an Schärfe und Dringlichkeit fehle, was sie an Unterwürfigkeit und Angeberei zu viel hätten. In der Rhetorik ist der Fachbegriff dafür die "epideiktische" oder "demonstrative" Rede, also Schaurede. Von den Redegattungen steht sie der Poesie, der Literatur am nächsten; sie darf, wenn auch nicht im Versmaß, sondern in gepflegter Prosa, schmuckreich sein und Wohlklang verströmen. Dass die antiken Sophisten überraschende Lobreden auf Mücken oder Ehebrecherinnen hielten und dafür Szenenapplaus bekamen, hat dem Image ebenso wenig genützt wie der Vorwurf, immer nur zu bestätigen, was die Leute hören wollen: Auch wer nicht das allerbeste Rhetorikcoaching genossen hätte, heißt es einmal bei Platon, "müsste immer noch, wenn er Athener unter Athenern lobte, Beifall finden".
Also könnte man die suspekte Lobrede für erledigt halten. Nun aber ist die paradoxe Situation unserer medialen Gegenwart diese: Politischen Reden hört eigentlich niemand mehr am Stück zu, weder im Fernsehen, Radio noch auf dem Marktplatz, und im Bundestag tut es auch nur eine Minderheit. Einzelsätze werden in Tweets oder Soundbites isoliert, als solche gemocht oder noch öfter skandalisiert. Und die Gerichtsrede findet kaum Hörer, ganz absehen davon, dass sie in einem Justizsystem ohne Geschworenengerichte wie in Deutschland ohnehin nicht floriert.
Ganz anders aber die Lobrede - sie ist der einzige Bereich der Rhetorik, wo man heute bis zum Ende zuhört! Landauf, landab gibt es ja immer noch Reden bei Hochzeiten, Geburtstagen, Trauerfeiern, bei Verabschiedungen, Jubiläen, Einweihungen, Gedenk-, Weihnachts- oder Abiturfeiern. Da sitzt man dann, kann nicht weg und nicht umschalten. Also haben die Sprache und das Lob ihre Chance. "Erfrischende Gedankensprünge gehören dazu, Schärfe des Geistes wetzt die Aufmerksamkeit", schreibt Iso Camartin. "Der Redner muss das Gefühl verbreiten, dass er nicht brav einem Regelkatalog folge, sondern frei mit Fertigkeiten schalte und walte."
Sicher, Reden auf Festen können quälend sein - ich erinnere mich zum Beispiel an einen Brautvater, der allen Ernstes sagte: "Diese Hochzeit ist ein Meilenstein in eurer Beziehung." Aber Feste ohne Reden sind triste Veranstaltungen. Iso Camartin geht gar so weit, "sprachlose und spracharme Lärm- und Polterfeste" zu verdammen, doch gute Bankette können ja beides verbinden: Gelungene Reden im gepflegteren Teil des Abends, dann darf später auch sehr gerne gelärmt und gepoltert werden.
In der Laudatio dürfen Kritiker mal ihre Angst vor Affirmation abschütteln
Ein ganz eigenes Reich hat die Lobrede in der Laudatio, wie sie bei den unzähligen Kultur- und Literaturpreisverleihungen im deutschsprachigen Raum gehalten wird. Da dürfen Kritiker mal ihre Angst vor Affirmation abschütteln. Nirgendwo auf der Welt dürfte mehr und aufwendiger gelobt werden. Auch die in Camartins Buch dokumentierten Reden verdanken sich überwiegend diesen Anlässen. Es sind Reden auf Nike Wagner, Durs Grünbein, Adolf Muschg oder Daniel Cohn-Bendit -, und sie lesen sich, wie das bei gebildeten Schweizern oft so ist: leicht betulich, aber sympathisch. Im Moment des Vortrags werden sie ihre angemessene, anregende Wirkung voll entfaltet haben.
Nun müsste dieser Geist der Laudatio noch irgendwie in die hassfixierte weitere Öffentlichkeit getragen werden, auf dass sich alle nur noch fragen: Warum diese Liebe? Denn Iso Camartin hat ja recht: "Wer im Leben nichts zu loben hat, führt ein trauriges Dasein."
Iso Camartin: Die Kunst des Lobens. Zur Rhetorik der Lobrede. Die Andere Bibliothek, Berlin 2018. 236 Seiten, 42 Euro.