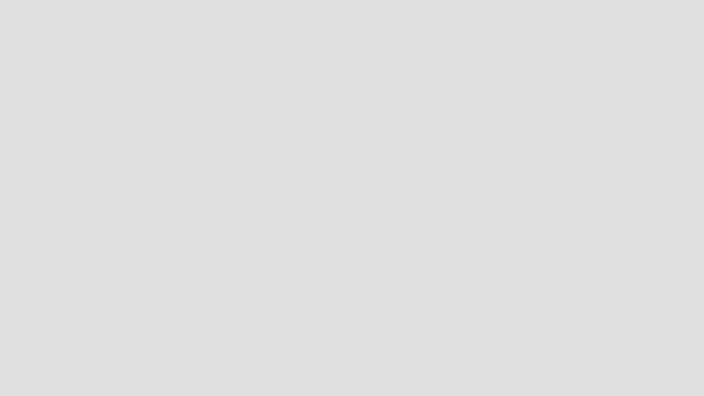Wer war noch mal Jeyne Poole? Im ersten Band von "A Song of Ice and Fire", dem viele Tausend Seiten langen Fantasy-Epos von George R. R. Martin, auf dem die TV-Serie "Game of Thrones" basiert, findet sich im Anhang ein Hinweis: Jeyne Poole ist die Tochter von Vayon Poole, dem Stewart von Winterfell, der Heimat der Starks.
Aha. Noch gewusst? Nein? Jeyne kommt am Anfang des ersten Buches kurz vor und wird auf den nächsten 3000 Seiten nur in Nebensätzen erwähnt. Im fünften Buch wird sie dann aber ziemlich wichtig. Als Leser denkt man da natürlich, dass der Autor das aber geradezu meisterhaft durchgeplant hat: Ganz am Anfang eine Figur vorstellen und immer irgendwie mitlaufen lassen, bis sie dann auf einmal Tausende Seiten später im Mittelpunkt steht und nicht erst eingeführt werden muss, sondern ganz natürlich immer schon da war. Das ist toll gemacht - und ein großes Problem.
Gerade ist die siebte und vorletzte Staffel der Fantasy-TV-Serie "Game of Thrones" angelaufen und es ist bereits die zweite, für die es keine Buchvorlage mehr gibt. Die Showrunner David Benioff und D. B. Weiss machten mit nur groben Anweisungen von Autor George R. R. Martin weiter, denn eine Serie, die so erfolgreich ist wie "Game of Thrones" und an der eine ganze Industrie hängt, lässt sich von so etwas wie einer fehlenden Geschichte nicht aufhalten.
Der bisher letzte Band der Reihe, in dem Jeyne ihren großen Auftritt hat, ist im englischen Original schon 2011 erschienen, seitdem heißt es, die Fortsetzung komme "bald". Geplant sind laut Martin noch mindestens zwei weitere Bücher. Die TV-Serie soll dagegen im kommenden Jahr enden. Warum braucht Martin so lange für die restlichen Bände, obwohl es doch nun schon die Serienvorlage gibt? In einem Blogbeitrag hat er vor wenigen Tagen verkündet, dass frühestens 2018 mit einem neuen Buch zu rechnen ist. Seine Stimmung beschrieb er als "quixotic", in Anspielung auf die berühmte Romanfigur Don Quijote von Cervantes, die vor lauter Ritterromanen den Verstand verloren hat.
Probleme mit der Fortsetzung ihrer Riesenwerke hatten schon viele Autoren. Cervantes hat es geschickt gemacht, indem er in seinem "Don Quijote" mehrere Erzählebenen ineinander verkeilte und sich so aber nicht einschränkte, sondern in diese undurchsichtige Ordnung jede noch so irre Wendung und Nebengeschichte einfügen konnte. Moderne Autoren lösen solche Probleme manchmal einfach mit fremder Arbeitskraft. Ken Follett verriet einmal in einem Interview mit der SZ, dass er ein ganzes Büro mit 22 Angestellten beschäftigt, die für ihn alles organisieren, was nicht direkt mit dem Schreiben zu tun hat. Zur Recherche engagiere er weitere, freiberufliche Hilfskräfte, und die Charaktere in seinen Romanen werden mit der Hilfe von Excel-Tabellen verwaltet.
Martins Methode, die eher an Modelle der Volkswirtschaft als an Literatur erinnert, war in Romanform ein Erfolgsrezept
Ähnlich arbeitet Stephen King. Als er 2001 seine "Dark Tower"-Serie fortsetzen wollte, beschrieb er das Gefühl am Schreibtisch so, als betrete man eine immer größer und größer gewordene, vollgestellte Lagerhalle, in der das Licht kaputt gegangen ist. Bei den ersten Bänden der Reihe arbeitete er sich noch selbst mit Textmarkern und Post-it-Notizen durch die Vorgänger. Nach vier Büchern war aber auch diese Methode nicht mehr praktikabel, weshalb er sich für die Arbeit an den letzten drei Bänden von seiner Assistentin Robin Furth ein persönliches, 240 Seiten umfassendes Lexikon mit allen Figuren, Orten und Begriffen aus den von ihm schon geschriebenen Büchern zusammenstellen ließ.
Aber nicht erst die Hochleistungs-Bestsellerautoren der Gegenwart verirren sich in ihren eigenen Texten. Auch Honoré de Balzac soll, um bei seiner aus 91 Romanen bestehenden "Comédie humaine" nicht den Überblick zu verlieren, Puppen benutzt haben, die für die einzelnen Charaktere standen und, wenn diese zum Beispiel gestorben waren, in einer Kiste abgelegt wurden. Es ist ein Trugschluss zu glauben, der Autor kenne sein eigenes Werk am besten und wisse über alles Bescheid, was in diesem vorgeht.
Grautöne und Ambivalenzen sind in Game of Thrones nicht vorgesehen
Im Fall von "Game of Thrones" ist die Lage besonders kompliziert, und daran sind Figuren wie Jeyne Poole und die Art, wie sie in die Geschichte eingebettet worden sind, schuld. Denn Martins Werk wird aus den wechselnden Perspektiven einer Vielzahl von Charakteren erzählt, um die sich wiederum Dutzende Nebenfiguren anordnen. "Game of Thrones", die Serie wie die Bücher, besteht eigentlich aus vielen kleinen Geschichten, die parallel stattfinden, sich überschneiden und häppchenweise nacheinander erzählt werden.
Das Besondere an den Romanen und der Serie sind nicht die angeblich so politische Handlung und die vielfältigen Charaktere, sondern die lebendige Dynamik, die aus dem Zusammenspiel dieser inzwischen mehr als zwei Dutzend Erzählperspektiven entsteht. Das, was erzählt wird, ist nur ein Teil des den Büchern zugrunde liegenden Gewebes von vielen Hundert, miteinander im Konflikt ihrer Interessen interagierenden Figuren. Damit das funktioniert, müssen die Figuren aber berechenbar bleiben, dürfen also nicht zu vielschichtig werden.
Jeyne Poole zum Beispiel wird als sehr hübsch, aber etwas naiv und ängstlich charakterisiert. Mehr Eigenschaften bekommt sie nicht, und bis auf eine Handvoll Hauptcharaktere, die eine Entwicklung durchmachen, verfährt Martin bei allen seinen Figuren so. Grautöne und Ambivalenzen sind nicht vorgesehen, denn sie würden dieses Beziehungskonstrukt ins Wanken bringen.
Wie aufwendig die Verwaltung von Hunderten Charakteren ist, verraten schon die Anhänge der Bücher, die bis zu 70 Seiten umfassen
Martins Methode, die eher an Modelle der Volkswirtschaft als an Literatur erinnert, war in Romanform überraschenderweise ein Erfolgsrezept, stößt aber jetzt nach fast 4500 Seiten an ihre Grenzen. Martin hat mit dem vierten und fünften Teil der englischen Ausgabe (der siebte und neunte in der deutschen Ausgabe) den Fehler gemacht, noch eine Ebene in sein multiperspektivisches Erzählen einzuziehen und die Figuren in zwei Gruppen einzuteilen, denen jeweils ein Buch gewidmet ist. Das hat nicht nur seine eigentlich gut funktionierende Erzählmethode unnötig verkompliziert, obwohl sie die Textmassen eigentlich übersichtlicher machen sollte, sie hat auch dieses besondere Zusammenspiel der Erzählstränge, das im Kopf des Lesers stattfand, zerteilt.
Jetzt scheint es, als hätten Figuren, die in dem einen Buch vorkommen, mit den Charakteren in dem anderen doch gar nicht mehr so viel gemeinsam. Es wird deutlich, dass Martin eigentlich weniger einen großen Roman als viele eher flache Geschichten erzählt, die er geschickt miteinander verwoben hat.
Dazu kommt, dass Martin so eine Art Buchhalter von Westeros, der von ihm erdachten Fantasy-Welt, geworden ist. Möchte er jetzt an einem der losen Enden weitererzählen, muss er immer mindestens die wichtigsten Figuren und ihre Motivation beachten. Was für eine Meinung hatte noch mal Catelyn Stark von Theon Greyjoy? Haben sich eigentlich Tyrion Lannister und Samwell Tarly schon einmal getroffen? Das sind Fragen, mit denen sich alle größeren Romanprojekte auseinandersetzen müssen. Bei "Game of Thrones" sind es aber Hunderte solcher Fragen, und die Fans sind gnadenlos, wenn sich die kleinste Ungereimtheit in die Bücher einschleicht.
Für jede Fortsetzung scheint nun nur noch eine von Tausenden Details und Wendungen vorbestimmte Nische verfügbar zu sein. Diese Nischen zu finden, ist, wie ein gigantisches Sudoku auszufüllen oder eben eine Excel-Tabelle auf dem neuesten Stand zu halten - das Schreiben wird zur Nebensache. Wie aufwendig die Verwaltung von Hunderten Charakteren und ihren Beziehungen untereinander ist, verraten schon die Anhänge der Bücher, die inzwischen selbst fast 70 Seiten umfassen.
Helfen könnte ein Schnitt mit dem alten System, eine neue Erzählweise oder eine radikal neue Idee. Warum nicht die Fernsehserie die Geschichte zu Ende erzählen lassen, wie sie es gerade tut? Nach dem Ende der Serie würden die nachgeschobenen Romane ohnehin wie eine Pflichtübung wirken. Cervantes hat auch im zweiten Teil von "Don Quijote" außerhalb des Romans weitergeschrieben: Das erste Buch ist wie selbstverständlich als physisches Objekt ein Teil der erzählten Welt des zweiten Buches. Deshalb wissen manche Figuren, die es gelesen haben, was auf sie zukommt, wenn sie den verrückten Junker Don Quijote treffen. Und Cervantes hatte wieder alle künstlerischen Freiheiten.