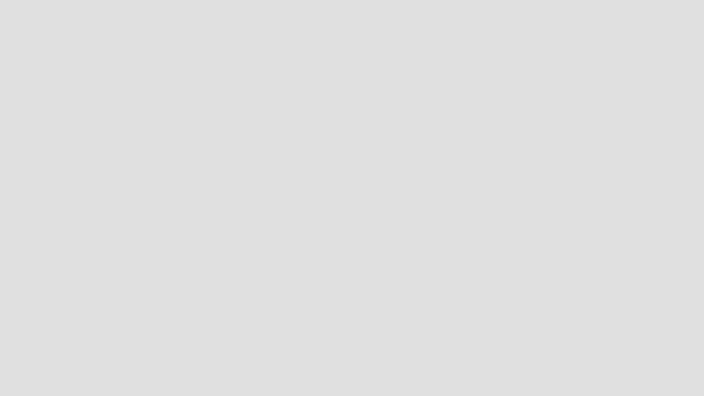Direkt nach dem britischen Votum für einen EU-Austritt empfand ich eine ungewohnte Taubheit. Erstmals hatte sich eine politische Katastrophe ereignet, die mich persönlich betraf. Auch wenn ich anfangs nicht genau ausdrücken konnte, wovor genau ich mich fürchtete, würde ich heute sagen, dass es um zwei gegenläufige Dinge ging: den Verlust eines europäischen Ideals, den ich immer als die Lebenswelt angesehen hatte, die am besten zu mir passt; und den Siegeszug einer Politik, die wenn schon nicht faschistisch, dann zumindest ihrem Wesen nach dem Faschismus ähnlich war: xenophob, rassistisch, nationalistisch. In einem Text für diese Zeitung zog ich damals stammelnd das Fazit: "Erst mal stimmt mich der Verlust einer Idee am traurigsten. Die Gefahren sind so weitreichend, dass man sie nicht in einem Punkt zusammenfassen kann."
Gefahr. Das Wort scheint mir sechs Monate später der treffendste Begriff aus meinem Statement. Das Gefühl der Gefahr hat sich seither nur verstärkt. Doch geht der Verfall schleichender vonstatten, als ich gedacht hätte. Wie kann man es ausdrücken? Die vergangenen sechs Monate haben mir gezeigt, was Zerbrechlichkeit bedeutet.
Die Europäische Union! Ich wuchs als begeisterter Mischling (deutsch im Original) in London auf. Meine Mutter ist Jüdin, mein Vater stammt aus dem Norden Englands. Dieses zweifache Erbe, die Möglichkeit verschiedener seltsamer Identitäten - wie habe ich das genossen!
Mein jüdischer Großvater mit litauischen Wurzeln kämpfte gegen die Nazis. Er tat es für Europa, nicht für Britannien. Trotzdem war er die britischste Person, die mir je untergekommen ist. Mit seiner Gerechtigkeitsliebe, der Kricketbegeisterung und seinem Charme stand er für die schönste Form der Britishness. Als Autor habe ich mir eine dementsprechende Mischlings-Theorie des europäischen Romans zurechtgelegt. Mein schriftstellerisches Ideal war, in ganz Europa verstanden zu werden. Auf eine einzige Sprache oder Literatur angewiesen zu sein, kam mir wie ein kategorialer Fehler vor.
Das entscheidende politische Ereignis meiner Kindheit war der Kollaps des Sowjetimperiums im Jahr 1989. Ich war elf, als Europa durch den Sieg über den Totalitarismus endgültig zu sich selbst zu finden schien. In den Folgejahren fiel mein privates Europa aufs Glücklichste mit der großen Epoche der EU zusammen. Die EU war die äußerliche, bürokratische Form für etwas, das mir im Inneren wild und anarchisch vorkam. Unser europäisches Erbe schien in Technicolor zu schillern, eine Collage aus vielfältigsten Einflüssen. Wie unschuldig! Wie historisch naiv!
Natürlich bedeutet der Verlust der äußeren Form nicht auch gleich den des wilden Ideals. Aber es ist schockierend zu sehen, wie sehr dieses Ideal eben doch von der äußeren Stabilität Europas abhing. Ohne sie fühle ich mich heimatlos, unsicher.
Dazu kommt die Erkenntnis, wie zerbrechlich die Form des politischen Umgangs miteinander ist. Das Ballett, dass Konservative und Sozialdemokraten um eine imaginäre Mitte herum aufführten, dieses Ballett, das britische Politik immer ausmachte, ist am Ende - aufgrund eines einzigen Referendums. Die Lager der Parteien wurden ersetzt durch die Befürworter von "Leave" und "Remain", was zeigt, wie fragil unser System ist. Es ist sinnlos geworden, einer Partei treu zu sein. Ohne solche Zugehörigkeiten verpufft aber die Struktur der Demokratie. Obwohl wir noch die Sprache der Demokratie und Freiheit benutzen, befinden wir uns bereits in einer neuen Landschaft voller Beschränkungen. In Diskussionen kontrovers um ein stillschweigend akzeptiertes Dogma zu kreisen, ist keine Freiheit. Freiheit bestünde darin, die Gültigkeit des Dogmas zu leugnen - des faschistischen Dogmas, dass man Menschen in ihrer Angst respektieren müsse, Menschen, die sich in der Angst vor Zuwanderung, in Engherzigkeit, Misogynie und Verdrossenheit einigeln.
Ich nahm die Sieger wahr wie Besatzer, die schleichend die Sprache okkupieren
Eine der besten Faschismus-Analysen stammt vom ungarischen Dichter János Pilinszky. In den Siebzigerjahren beschrieb er voller Grauen, wie Faschismus einer Welt des Kleinbürgertums entspringt, einer Welt kleiner Entscheidungen, kleiner Vergnügen, kleiner Frustrationen. Genau diese Frustrationsgefühle werden jetzt für unantastbar erklärt. Und damit bin ich noch nicht einmal angelangt bei Donald Trump, der transatlantischen Ausweitung dieses Desasters. Kurz nach Trumps Sieg schrieb ich meinem Freund Daniel Kehlmann nach New York. Er schickte mir einBrecht-Gedicht aus dessen "Steffinscher Sammlung", geschrieben 1940 im Exil. Zwei Verse packten mich besonders:
Im Lautsprecher
Höre ich die Siegesmeldungen des Abschaums.
Wochenlang hatte ich keine Nachrichten mehr gehört. Ich konnte die Siegesmeldungen der von mir Verachteten nicht ertragen. Ich nahm sie wahr wie fremde Besatzer. Vor allem überwältigte mich ihre schleichende Besetzung der Sprache. Etwa als Donald Trump twitterte: "Viele Leute sähen Nigel Farage gerne als britischen Botschafter der USA. Er wäre großartig in diesem Amt!" Viel besorgniserregender als die idiotische Aussage selbst ist die Berichterstattung der britischen Presse darüber. Wenn man den Satz schon nicht ignoriert, hätte man ihn mit beißendem Spott kommentieren müssen. Doch scheint der Drang, gewöhnliche Formen aufrechtzuerhalten, so stark zu sein, dass man Trumps Äußerung als "unkonventionelle" Diplomatie bezeichnete. Und als Wissenschaftler bewiesen, dass ein EU-Austritt die wissenschaftliche Gemeinschaft schädigen würde, wurden die Brexit-Unterstützer in den Medien als "Kritiker" dieser "Position" dargestellt statt als irrationale Leugner empirischer Beweise.
Brechts Gedicht endet mit einer Miniatur schöner Hoffnung:
Hoch oben in Lappland
Nach dem nördlichen Eismeer zu
Sehe ich noch eine kleine Tür.
Ich liebe die Idee, dass es irgendwo noch immer diese Tür gibt, egal wie kalt der arktische Winter ist. Sie zu leugnen wäre melodramatisch. Doch sollten wir auch nicht an ihre ewige Verfügbarkeit glauben, wie wir es im Zeitalter der Unschuld taten. Jetzt ist die Ära des Verfalls. Diese Ära verlangt nach akrobatischerem, mutigerem Denken. Sie verlangt im Grunde, in ganz neuen Kategorien zu denken.
Adam Thirlwell, geboren 1978, lebt in London. 2015 erschien der Roman "Grell & Süß" (S. Fischer Verlag). Deutsch von Jonathan Horstmann.