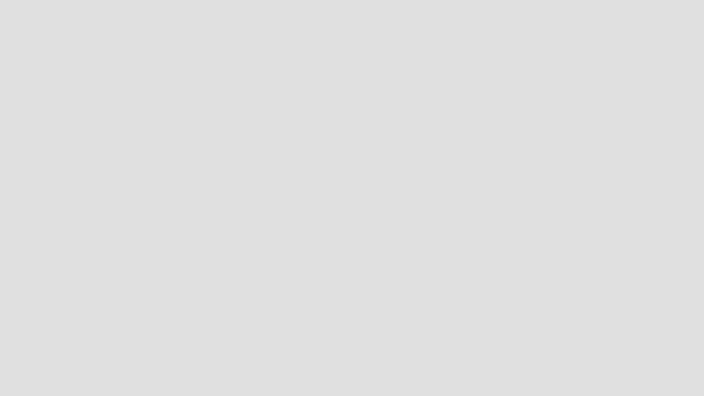Barbara Kisseler ist die erste Frau und die erste Politikerin, die zur Präsidentin des Deutschen Bühnenvereins gewählt wurde. Lobbyarbeit für die Theater und Opern - das ist heute offenbar vor allem die Fähigkeit, die Bühnen gegen Einsparungen zu verteidigen. Kisseler, seit 2011 Hamburgs Kultursenatorin, gibt sich kämpferisch.
SZ: Was bedeutet Ihnen Theater?
Barbara Kisseler: Ich könnte auf vieles verzichten. Auf Theater will ich nicht verzichten. Ich brauche das. Ich habe dort Erlebnisse, die mich verändern. Ich bin überzeugt, dass ich Menschen anders wahrnehmen würde, wenn ich das Theater nicht vor vielen Jahren für mich entdeckt hätte.
SZ: Einer Ihrer Vorgänger an der Spitze des Bühnenvereins, Gustaf Gründgens, hatte es leichter: Zu seiner Zeit haben die Städte ihre Theater mit Stolz finanziert. Heute haben die Kommunen weniger Geld, der Druck auf die Theater wächst.
Durch die Schuldenbremse und wachsende Sozialausgaben werden die Spielräume für die Städte enger. Gegen das scheinbare Erodieren ihrer Bedeutung arbeiten die Theater seit Langem, auch indem sie gesellschaftliche Aufgaben übernehmen. Auch wenn es vielleicht etwas zu groß klingt, das Theater kann ein Ort sein, an dem die Gesellschaft mittels der Kunst über ihre Konflikte, Defizite, Möglichkeiten nachdenkt. Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz hielt seine Grundsatzrede zur Flüchtlingsproblematik im Thalia-Theater und nicht im Rathaus. Das ist auch ein Bekenntnis zum Theater als Ort der bürgerlichen Öffentlichkeit.
SZ: Wird es schwieriger, die öffentliche Finanzierung der Theater zu rechtfertigen?
Genau das darf nicht passieren. An vielen Orten sind Stadttheater unglaublich wichtige soziale Orte der Begegnung, auch so ein nach harten Sparrunden kleingeschrumpftes Theater wie in Wuppertal. Rostock, wo die Bürger ihr Theater gegen Teile der Kommunalpolitik verteidigt haben, ist ein gutes Beispiel dafür, dass durch bürgerschaftliches Engagement Fehlentscheidungen korrigiert werden können.
SZ: Bonn ist ein Gegenbeispiel. Dort haben Eltern ihre Kinder in T-Shirts mit dem Slogan "Ich will ins Schwimmbad, nicht in die Oper" gegen die Hochkultur auf die Straße geschickt.
Diese Instrumentalisierung der Kinder ist verantwortungslos, die ganze Polemik ist maßlos. Stadtteilprojekte wie Björn Bickers "New Hamburg" zeigen, dass es gelingen kann, auch Kinder aus Milieus, die nichts mit Theater zu tun hatten, für diese Erlebnisse zu öffnen.
SZ: Wird in den Theatern vor lauter Bürgerbühnen und Stadtteilprojekten die Sozialarbeit wichtiger als die Kunst?
Das hoffe ich nicht. Ich bin überzeugt davon, dass es bei vielen Menschen eine große Sehnsucht nach ästhetisch vermittelter Welterfahrung gibt. Es ist sicher nicht so, dass die Theater die originären Aufgaben von Sozial- und Bildungspolitik mal nebenbei miterledigen können.
SZ: Vor 20 Jahren standen noch 3000 professionelle Schauspieler im Bühnenjahrbuch, heute sind es noch 2000. Die Bühnen arbeiten mehr mit Freiberuflern, diese aber verdienen laut Künstlersozialkasse im Schnitt 1250 Euro brutto im Monat. Der Bühnenverein kann da hoffentlich einiges bewegen. Wir werden uns um das Recht auf Arbeitslosengeld kümmern müssen. Wer als freiberuflicher Schauspieler, Regisseur oder Bühnenbildner nicht genug versicherungspflichtige Arbeitstage hat, und das geht vielen so, zahlt zwar in die Arbeitslosenversicherung ein, erwirbt aber keine Ansprüche auf Arbeitslosengeld. Wir haben uns alle ein bisschen zu sehr daran gewöhnt, dass das kreative Freiberuflertum einhergeht mit sozial unverantwortbaren Lebensverhältnissen. Das kann auf keinen Fall so bleiben.
SZ: Dennoch: Die Mindestgage wurde von 1650 auf ganze 1765 Euro brutto erhöht. An kleinen und mittleren Theatern verdienen auch erfahrene Protagonisten nicht viel mehr als 2000, 2300 Euro. Die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt wächst und der Produktionsdruck in den Häusern.
Das kann man nicht oft genug sagen. Selbst in der Politik gibt es teilweise absurde Vorurteile von Spitzengagen. Das können nur Leute glauben, die noch nie ein Theater von innen erlebt haben. Theater ist harte, oft schlecht bezahlte Arbeit. An vielen Häusern haben Schauspieler über Wochen keinen freien Tag.
SZ: Abseits der großen Häuser sind die Künstler schlechter bezahlt und weniger abgesichert als Technik und Verwaltung.
Oft ist es am einfachsten, den künstlerischen Etat zu reduzieren. Gefährlich wird es, wenn Haushaltspolitiker reflexhaft fordern, im frei verfügbaren Etat zu sparen. Damit gefährdet man den eigentlichen Zweck dessen, was man fördern will. Denkt man das zu Ende, sind die Theater, in denen gar nicht mehr gespielt wird, die preiswertesten. Aber wollen wir, dass das Theater zum Teil der Unterhaltungsindustrie wird? Oder wollen wir es als künstlerischen Ort ernst nehmen, der uns die Möglichkeit der Konzentration bietet? Das wird, gerade weil es uns im Multitasking-Alltag oft fehlt, wichtiger. Deshalb tue ich mich auch etwas schwer mit der Euphorie über eine Übertragung von Theatervorstellungen im Internet. Eigentlich ist das Angebot des Theaters, sich gemeinsam mit anderen mit allen Sinnen auf eine Sache einzulassen. Das ist das Kontrastprogramm zur digitalen Einsamkeit.
SZ: Die Berliner Volksbühne wird bald vom Repertoire-Theater zu einem genreübergreifenden Produktionsort mit flexibleren Strukturen. Ist das Ensemble-Theater passé ?
Überhaupt nicht. Ensembletheater sind unglaublich beweglich, ästhetisch offen und effizient. Viele arbeiten längst mit Performern und der Freien Szene zusammen. Ich halte überhaupt nichts davon, Theaterformen gegeneinander auszuspielen. Besonders fragwürdig wird das, wenn das zum Zweck der Selbstprofilierung geschieht. Dass die Diskussion um die Zukunft der Volksbühne arg unglücklich gelaufen ist, hatte auch mit der Form der Kommunikation zu tun. Mit der Berufung von Chris Dercon scheint eine Lösung gefunden zu sein.
SZ: Der Chef der Londoner Tate Modern, ein profilierter Museumsmann, soll die Volksbühne leiten.
Man wird sehen, ob das eine kulturpolitisch notwendige, künstlerisch überzeugende Entscheidung war. Ich persönlich habe da meine Zweifel. Einerseits sind wir stolz auf unsere unglaublich vielfältige Theaterlandschaft, Künstler aus anderen Ländern beneiden uns, wir zählen sie zum Weltkulturerbe. Andererseits stellen wir die Strukturen, die sie am Leben halten, infrage. Das ist absurd.
SZ: In den Niederlanden haben Rechtspopulisten erfolgreich Wahlkampf gemacht mit dem Versprechen, Kultursubventionen zu streichen. Fürchten Sie hier Ähnliches?
Das betrifft ja nicht nur die Hochkultur. Natürlich sind solche Phänomene erschreckend. Wir müssen das Theater, und überhaupt die Bedeutung von Kultur, gegen solche Anwürfe verteidigen. Wir haben früher in der Frauenbewegung immer gesagt: Gemeinsam bleiben wir lästig. Und genau das habe ich vor.