Es könnte im Museum auch zugehen wie beim Arzt. Der Mensch wird verkabelt, vermessen und aller möglicher körperlicher Reaktionen überführt, von denen er noch nichts wusste. Monet beruhigt Ihren Herzschlag. Neo Rauch lässt Sie frösteln. Bei Rothko kommen Sie ins Schwitzen und die Abstraktionen von Gerhard Richter machen Sie nervös. Man bekäme dann gegen Rückenschmerzen etwas Giovanni Bellini verschrieben, gegen Kreislaufschwäche eine Dosis El Greco und zur Hypersensibilisierung gegen Heuschnupfen regelmäßig Ruisdael.
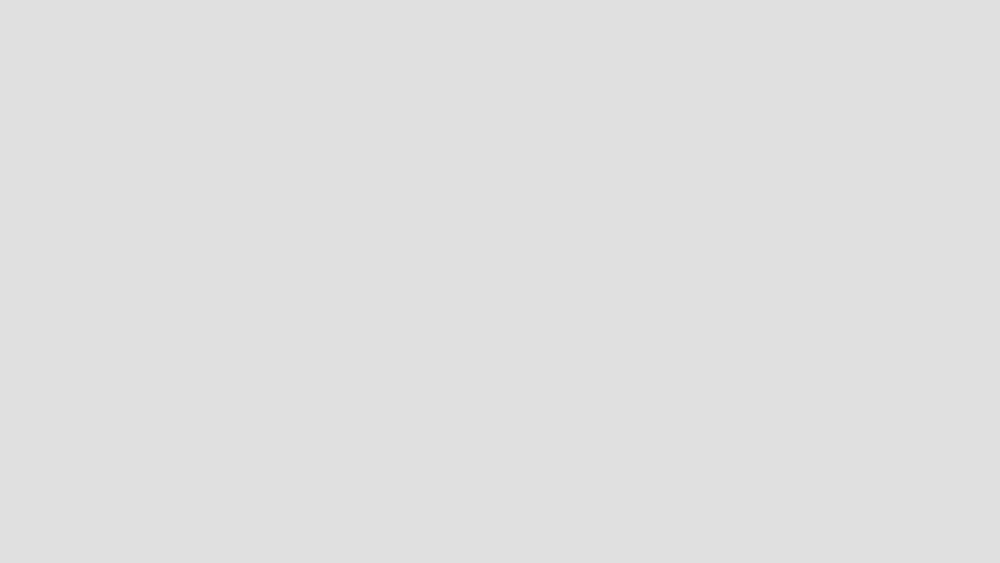
Soweit ist es noch nicht. Doch dass Kunst körperlich wirkt und die ganze Palette des Physischen von zarten Gefühlen über Angst bis Schmerz hervorrufen kann, wissen Künstler und manchmal auch Kunsttheoretiker seit jeher. Wie allerdings genau das vor sich geht, war bislang Privatsache des Museumsgängers. Nun diagnostiziert ein interdisziplinäres Projekt in St. Gallen den Betrachterkörper auf Schritt und Tritt. Besucher des örtlichen Kunstmuseums werden gebeten, einen Handschuh anzuziehen, der dem Kontrollteam Signale sendet, wie lange sich das Versuchsobjekt vor welchem Bild befindet. Ein angeschlossenes EKG misst das Herz und eine Art Lügendetektor registriert, bei welchem Anblick die Betrachterhand feucht wird.
Weil auch die Forschungsgruppe um Martin Tröndle weiß, dass Medizin nicht alles ist, werden die Probanden vorher nach ihren Erwartungen befragt und hinterher danach, warum sie gerade vor diesem oder jenem Werk innehielten. Dabei stellte sich bislang - das Projekt läuft in der zweiten Woche - zum Beispiel heraus, dass Günther Ueckers Nagelkunst aus unterschiedlichen Gründen hohe Aufmerksamkeit erregt: Manche Leute bleiben aus Ärger stehen, andere aus Begeisterung. Vorgesehen sind noch weitere Tests mit den Handschuhträgern. Ein Original soll gegen eine Kopie ausgetauscht, Künstlernamen abgedeckt und Werke umgehängt werden.
Spätestens hier scheint es, als würden nicht die Besucher, sondern die Werke geprüft, nämlich auf ihre Wirkkraft auch unter schwierigen Bedingungen. Nicht zufällig operiert das Projekt außer mit allerlei kunstsoziologischen und psychogeografischen Begrifflichkeiten auch mit Walter Benjamins Verständnis von der Aura des Kunstwerkes - in einer eher zynischen Abwandlung: Ein Werk, das ohne Beschilderung nicht die Blicke eines reizüberfluteten Publikums erheischt, entauratisiert sich hier selbst.
Nun ist es ja interessant, mehr über die Kunstbetrachter zu erfahren. Lange, besonders in der Genieästhetik des 19. Jahrhunderts, spielten sie nur eine Nebenrolle im Reden über Kunst. Das ist, etwa durch die historische Rezeptionsästhetik von Wolfgang Kemp, längst passé. Wer heute ein Kunstwerk interpretieren will, muss die Betrachter mitdenken, allen voran diejenigen, für die ein Werk einst gemalt, gezeichnet, gemeißelt wurde.
Wohin aber mag es führen, wenn jede Körperregung auch der heutigen Museumsbesucher durchleuchtet wird wie in den Warenhäusern und Supermärkten, für die solche Messmethoden einst erfunden wurde? Dann müssen Kuratoren bald nach dem Prinzip Käseregal hängen - demnächst abgelaufene Ware immer in Blickrichtung, die guten Stücke etwas versteckt. Keine Texte mehr auf Ausstellungswände, weil die sicher keiner liest. Sponsorengelder gäbe es nur noch nach vorigem Probelauf - anhand einer Ausstellung von Kopien vor repräsentativ ausgewähltem Publikum müsste sich die Kandinskyschau erst einmal beweisen. Und Kopfschmerzkunst oder Klaustrophobisches von Gregor Schneider würde in separate Gruselkabinette verbannt.
Im großen Maßstab angewandt, müsste die Handschuh-Methode vermeintliche Körpergefühle hochrechnen und würde so fragwürdig wie die Quote beim Fernsehen. Auch wenn die Forscher aus St. Gallen dies nicht wollen: Ihre Besuchermessung verabsolutiert momentane Befindlichkeit und riskiert mit dieser schon ignoranten Selbstbezüglichkeit der Heutigen, alles Gemachte, historisch Gebundende der Kunst zu verdrängen. Ähnlich geht die Berliner "Association of Neuroesthetics" vor, die die Nachhaltigkeit von Kunstwerken gerne rein neurobiologisch erklären möchte.
Doch die Kunst wird auch Mediziner überleben, die die Wirkung des Ästhetischen nur aushalten, wenn sie sie vermessen.