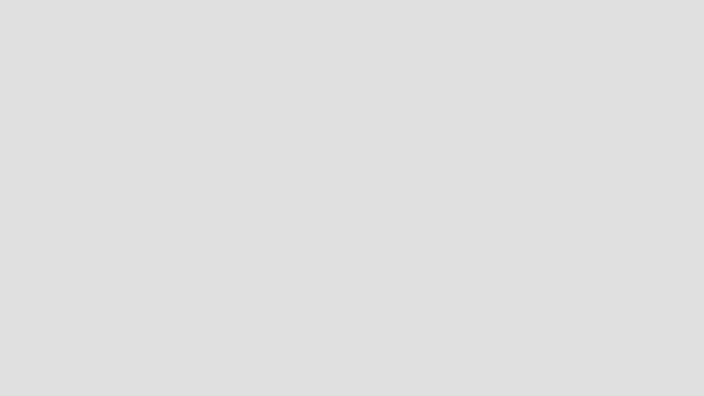Viele Arbeitgeber haben Angst - oder Vorurteile. Wenn Bewerber fremde Namen tragen, lehnt die Firma sie oft ab. Ob nun aus Angst oder wegen Vorurteilen, das Ergebnis ist gleich schlecht: Viele Bewerber mit arabischen oder afrikanischen Wurzeln bekommen trotz guter Ausbildung in Deutschland nicht den angestrebten Arbeitsplatz.
Es ist schlimm genug, dass Ausländer auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt werden. Aber Diskriminierung betrifft nicht nur traumatisierte Geflüchtete mit Sprachproblemen, sondern auch Deutsche. Wenn sich jemand mit dem Namen Arben als Verkäufer bewirbt, hilft ihm auch der Geburtsort Bremen wenig. Obwohl er vielleicht kein Wort Albanisch spricht, steckt der Arbeitgeber ihn häufig in eine Schublade - zu den Albanern mit ihren rivalisierenden Familienclans, von denen Zeitungen berichten.
Das Antidiskriminierungsgesetz soll davor schützen, dass Menschen aufgrund ihrer Religion, Herkunft oder Ethnie benachteiligt werden. Demnach müssen bei Verdacht auf Diskriminierung die Arbeitgeber beweisen, dass nicht etwa die Hautfarbe der Grund war, dem Bewerber abzusagen. Aber die Richter nehmen das Gesetz nicht ernst, kritisieren Arbeitnehmeranwälte. Das liegt auch daran, dass der Gesetzgeber es lange nicht für nötig hielt, die entsprechenden EU-Vorgaben umzusetzen. Jetzt tun die Richter Diskriminierung als Gejammer ab. Es kommt zwar oft vor, dass Menschen benachteiligt werden. Es kommt nur selten vor, dass Arbeitgeber dafür belangt werden.
Alte Einstellungsstrategien taugen nichts in der bunten Gesellschaft
Wenn es den politischen Willen gäbe, ließen sich die Rechte von Menschen mit Migrationshintergrund ernsthaft stärken. In Nordrhein-Westfalen wird diskutiert, Namensänderungen zu erleichtern. Farhad Pahlavi könnte sich Frank Pahlke nennen, um seine Jobchancen zu verbessern. Schlimm, wenn das nötig ist - ein Mittel zur Selbsthilfe ist es dennoch.
Allerdings hilft es dem Bewerber noch nicht wirklich weiter, wenn er dann im Vorstellungsgespräch sitzt. Denn Vorgesetzte und Personaler bevorzugen unbewusst Kandidaten, die ihnen ähnlich sind. Es gibt ihnen ein gutes Gefühl, wenn Mitarbeiter ähnliche Lebensläufe, Ansichten und kulturelle Erfahrungen wie sie selbst mitbringen; der Typus hat sich in der Firma schließlich auch bewährt.
Doch diese Einstellungsstrategie taugt nichts mehr in der bunten Gesellschaft. Kompetenzen, Leistungsfähigkeit und Engagement sind in der Bevölkerung gleichmäßig verteilt - über Ethnien und Religionszugehörigkeiten ebenso wie über Geschlechter, Alter oder sexuelle Identitäten. In der Realität der meisten Firmen sehen die Mitarbeiter jedoch erschreckend gleich aus. Ein Fehler. Wer nur aus der Gruppe junger weißer Christen schöpft, schadet sich wirtschaftlich - zumal in Branchen, in denen Fachkräfte bereits knapp sind. Betriebe, die weiter daran festhalten wollen, müssen untergehen. Schon etwa jeder Fünfte im Ausbildungsalter hat Eltern mit Migrationsgeschichte. Und es werden mehr.
Wenn Angst der Grund für Diskriminierung ist, helfen diese Argumente jedoch nichts. Betriebe werden sich zwar an die vermeintlich Fremden herantasten; Menschen aus christlichen und industrialisierten Ländern behandeln sie jetzt schon wie Deutschstämmige, das haben Forscher zumindest für einige Berufsgruppen belegt. Aber es besteht die Gefahr, dass einige zurückbleiben: eine Gruppe chancenloser Menschen, vor allem Schwarze oder Muslime. Ihnen ist nur geringfügig mit Regeln oder Quoten für die Betriebe zu helfen. Arbeitgeber mit diffusen Ängsten werden Wege finden, diese zu umgehen.
Schritte der Annäherung müssen - im eigenen Interesse - aus den Unternehmen kommen. Anonymisierte Bewerbungsverfahren sind eine Option. Aber Lebensläufe ohne Foto, Name, Wohnort, Jahreszahlen, Muttersprache und Zeugnisse, in denen jeder Hinweis auf das Geschlecht geschwärzt werden muss, sehen nicht nur kümmerlich aus - sie lassen auch kaum zu, sich ein Bild von X zu machen. Hat sich jemand hochgearbeitet oder nichts aus seinen Privilegien gemacht?
Personaler könnten stattdessen anfangen, Lebensläufe von unten zu lesen: Vorherige Positionen, Ausbildung, Schule, zum Schluss Name und Gesicht. In Onlineverfahren ließe sich das leicht umsetzen - zur Selbstkontrolle mit einer Schranke vor den sensibelsten Informationen, an der eine Vorentscheidung über den Kandidaten getroffen werden muss. Noch besser wäre es, vor allem in der Personalabteilung auf Diversität zu setzen: ja, Schwarze in die Personalabteilung!