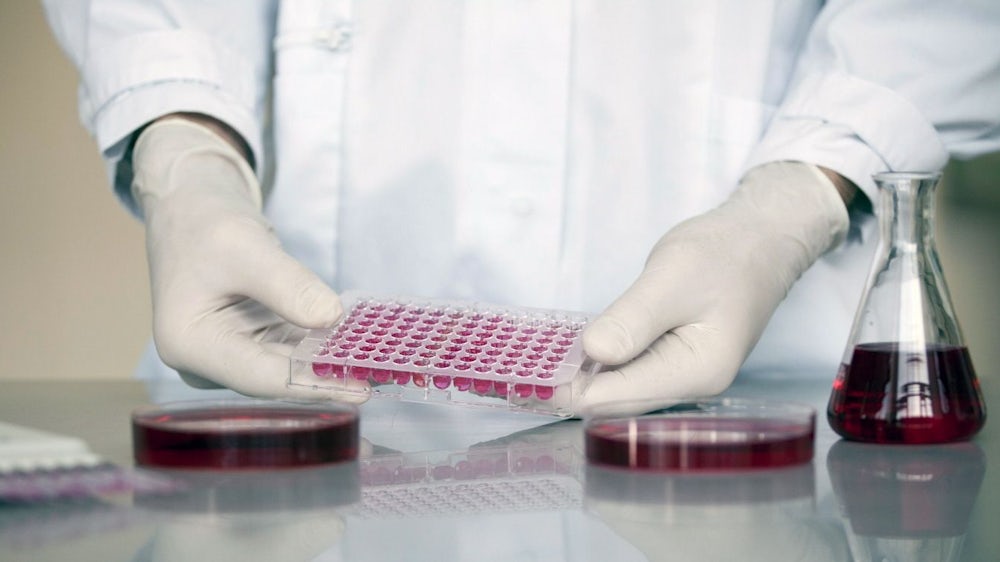Wer ein Herz hat, dem muss die Geschichte von Mary Pazdur nahegehen. Die blonde, lebenslustige Frau arbeitete jahrelang als Krankenschwester in der Krebsmedizin. 2012 erkrankte sie selbst an Eierstockkrebs. Sie hatte schon viele Patientinnen daran leiden und sterben sehen und wusste daher aus eigener Anschauung, wie sehr sich Betroffene Hoffnung machen, wenn mit neuen Therapiemethoden die Aussicht auf Heilung oder zumindest auf ein paar Monate mehr Lebenszeit befeuert wird.
Ob derartige Behandlungsverfahren gegen Krebs in den USA zugelassen werden, ist erheblich von dem Votum eines Mannes abhängig - Richard Pazdur. Der Arzt leitet seit 1999 die Abteilung für Krebsmedikamente der mächtigen Arzneimittelbehörde FDA, die über Zulassungsanträge für neue Pharmaka entscheidet. Und er ist Mary Pazdurs Ehemann. Was macht es mit einem Menschen, wenn sich durch einen Schicksalsschlag im Familienkreis plötzlich berufliche Anforderungen und private Nöte kreuzen? Schließlich hat Pazdur mit darüber zu entscheiden, wie schnell Medikamente gegen Krebs auf den Markt kommen - mithin über Behandlungen, die seiner kranken Frau helfen könnten.
"Ich habe inzwischen einen größeren Sinn für Dringlichkeit", sagte Richard Pazdur kürzlich in einem Interview der New York Times. "Ich bin auf dem Kreuzzug, um die Begutachtung zu beschleunigen und Anträge schneller abzuschließen." Klar, die Krankheit seiner Frau sei einer der Faktoren gewesen, die ihn zum Richtungswechsel bewegt hätten, gibt der Krebsarzt zu, dem früher eine streng wissenschaftlich abwägende Haltung zugebilligt wurde.
Der aufsehenerregende Fall des Ehepaars Pazdur
Fortschritte in der Forschung und ein 2012 verabschiedetes Gesetz, dass eine engere Zusammenarbeit der FDA mit den Arzneimittelherstellern gefördert habe, hätten aber ebenfalls dazu beigetragen, dass er Patienten neue Medikamente schneller verfügbar machen will.
Der Aufsehen erregende Fall des Ehepaars Pazdur und ihre persönliche Verquickung haben eine Diskussion wieder aufflammen lassen, die von Aids-Aktivisten zu Beginn der 1990er-Jahre aufgebracht wurde: Können Todkranke wirklich darauf warten, bis ein neues Medikament alle Hürden der Zulassung genommen hat? Ist es Menschen zuzumuten, alle bürokratischen Regularien des Gesundheitssystems zu ertragen, wenn sie nur noch kurze Zeit zu leben haben?
Trügerischer Therapieerfolg: Die Laborwerte sind zwar besser, doch es sterben mehr Menschen
"Klar, bürokratische Verzögerungen müssen aus der Welt geschafft werden und die maximale Geschwindigkeit der Zulassung ist natürlich wünschenswert", sagt Gerd Antes, der in Freiburg das Cochrane-Zentrum leitet, das die Qualität klinischer Studien bewertet. "Aber es gibt zu viele Beispiele für Irrwege und auf die Abwägung von Schaden und Nutzen darf niemals verzichtet werden." Schon länger versuche die Industrie, die Schranken für die Zulassung immer niedriger anzusetzen. "Das ist der falsche Weg - und als Arzt muss man schließlich auch den Grundsatz beherzigen, nicht zu schaden."
Für Wolf-Dieter Ludwig sind die Anforderungen an die Zulassung neuer Krebsmittel "eh schon zu lasch - und sie werden immer weiter aufgeweicht". Der Onkologe ist Vorsitzender der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft und sieht als Chefarzt der Krebsmedizin in Berlin-Buch jeden Tag Patienten, die nicht mehr lange zu leben haben.
"Von den zehn Krebsmitteln, die 2014 neu auf den Markt kamen, sind neun beschleunigt zugelassen worden", so Ludwig. "Die Kenntnisse, die man bei beschleunigter Zulassung hat, sind naturgemäß geringer. Die Unsicherheit steigt und man kann immer weniger darüber sagen, wie gut die Mittel wirken und ob sie sicher genug für Patienten sind."
Viele neue Krebsmittel verlängern die Lebenszeit der Betroffenen gerade mal um vier oder sechs Wochen
Die Unsicherheit wäre zwar eher zu verkraften, wenn zuverlässige Daten zu Wirkungen und Nebenwirkungen nach der Zulassung nachgeliefert würden. Doch auch das sei nur selten der Fall, kritisiert Ludwig. Viele neue Krebsmittel, die bei Schwerkranken und Angehörigen Hoffnung auslösen, verlängern die Lebenszeit der Betroffenen gerade mal um vier oder sechs Wochen - und das oft auf Kosten schwerster Nebenwirkungen und Komplikationen.

Viele Kranke bekommen noch kurz vor ihrem Tod eine Chemotherapie. Nicht immer ist das sinnvoll. Ärzten wie Patienten gelingt es oft nicht, sich über Ziele in der letzten Lebensphase zu verständigen.
"Es heißt ja oft, bei Krebskranken im fortgeschrittenen Stadium sei jede Nebenwirkung egal - aber das stimmt doch nicht", sagt Gerd Antes. "Die Zeit, die einem bleibt und die man für den Abschied von der Familie braucht, kann dadurch extrem belastet werden." Mary Pazdur hatte im Verlauf ihrer Erkrankung irgendwann einer neuen experimentellen Therapie zugestimmt, an deren Zulassung ihr Mann allerdings nicht beteiligt war. Sie litt unter starken Nebenwirkungen, ihr Herz schwoll an, der Blutdruck sank und sie fühlte sich so schwach, dass sie kaum den Weg ins Badezimmer zurücklegen konnte und die Behandlung abbrechen musste.
Nach dieser Erfahrung ließ sich Mary Pazdur auf keine unerprobte Therapiemethode mehr ein, sondern begab sich zur Betreuung in ein Hospiz, als es ihr zunehmend schlechter ging. "Statt dass Forscher und Ärzte die Toxizität von Medikamenten erheben, sollten wir endlich anfangen, die Patienten selbst die Nebenwirkungen beurteilen zu lassen", fordert Richard Pazdur. "Das ist ein wichtiges Thema und bisher vernachlässigt."
In der Tat wird viel geschönt und verschwiegen, um neue Krebsmedikamente in einem möglichst günstigen Licht erscheinen zu lassen. Für die Zulassung werden immer wieder Einzelstudien akzeptiert, die nur wenige Patienten beinhalten, denen es noch dazu viel besser geht, als es die Krebsärzte gewohnt sind und deren Therapieverlauf sich deshalb nicht auf den Klinikalltag übertragen lässt.
Als Kriterien für den Erfolg einer Therapie werden so genannte Surrogatparameter verwendet - Ersatzwerte, die eine Wirkung belegen sollen. Typisch in der Krebsmedizin sind beispielsweise die Ansprechrate und die progressionsfreie Überlebenszeit. Das klingt zwar gut, doch der Anteil der Patienten, deren Laborwerte auf eine Behandlung ansprechen und deren Tumorzellen eine Weile nicht weiter wuchern, hat wenig damit zu tun, wie gut es Patienten tatsächlich geht und wie lange sie leben.
So verzögert Bevacizumab (Avastin) zwar das Tumorwachstum bei fortgeschrittenem Brustkrebs, doch einen Nutzen hatten Patientinnen davon nicht. Und ein 2013 zugelassenes Mittel gegen Tuberkulose verringerte zwar die Bakterienzahl im Auswurf, was in der Zulassungsstudie auch als Surrogatparameter für den Erfolg der Behandlung angegeben wurde. Allerdings starben viermal so viele Patienten unter dieser Therapie als in der Vergleichsgruppe.
Die Zulassung für Medikamente beschleunigen? Schneller geht es doch kaum noch
"Es ist zwar vollkommen nachvollziehbar, sich an jeden Strohhalm zu klammern und sich auch mit schlecht untersuchten Medikamenten behandeln lassen zu wollen", sagt Krebsarzt Ludwig. "Ich habe aber ein Problem damit, wenn diese Mittel mit einem riesigen Erwartungsdruck als neue Wunderwaffen aufgebaut werden und das durch keinerlei Belege gerechtfertigt ist. Das ist nicht vertretbar, wir haben schließlich auch die Verpflichtung, unsere Patienten zu schützen."
Wenn ein neues Mittel gegen Krebs auf den Markt kommt, kann oft nur kurze Zeit Geld damit verdient werden. Mit der Idee für ein neues Medikament und den entsprechenden Wirkmechanismus kann Patentschutz für die Substanz beantragt werden, oft umfasst er 20 Jahre. Dann sind aber im Durchschnitt sieben Jahre klinischer Studien und Dutzende Millionen Euro nötig, bis der Zulassungsantrag gestellt werden kann.
Jeder Monat, den ein Mittel auf dem Markt ist, bedeutet Millionengewinne für den Hersteller. Schließlich ist die Zeit knapp. Gerade in der Krebsmedizin sind "neue" Medikamente oft schon nach zwei, drei Jahren wieder überholt.
"Durchbrüche in der Therapie gibt es nur selten"
Die Politik kommt der Pharmaindustrie regelmäßig entgegen. 2012 hat der US-Kongress zur Beschleunigung der Zulassung das Programm "Breakthrough Therapy" auf den Weg gebracht. Wie die Programme "Fast-Track", "Beschleunigte Zulassung" und "Priorität in der Begutachtung" dient es einzig dazu, Medikamente schneller auf den Markt zu bringen, vorausgesetzt es handelt sich um schwere Erkrankungen, für deren Behandlung es keine therapeutische Alternative gibt.
"Jeder Arzt weiß, dass es Durchbrüche in der Therapie nur selten gibt", sagt Krebsarzt Ludwig. "Und es ist kaum erträglich, wie die Begriffe ,schwere Erkrankung' und ,keine therapeutische Alternative' aufgeweicht werden."
Im Mai 2015 wurde der "21st Century Cures Act" in den USA als Gesetzesvorlage eingebracht, um die Zulassung neuer Therapien weiter zu beschleunigen. "Wir haben bereits das schnellste Zulassungsverfahren weltweit und entfernen uns immer weiter vom Patientenschutz", warnten die Harvard-Mediziner Jerry Avorn und Aaron Kesselheim kürzlich im New England Journal of Medicine. "Statt uns in die Zukunft zu katapultieren, könnte uns diese Regelung Probleme bringen, die wir im 20. Jahrhundert hinter uns gelassen zu haben glaubten."
Seit der Diagnose seiner Frau 2012 verringerte sich die Begutachtungszeit für neue Krebsmittel in der FDA-Abteilung von Richard Pazdur von sechs auf fünf Monate. Ein Medikament gegen Eierstockkrebs, dem Pazdur 2014 - gegen eine Expertenmehrheit - die Zulassung bewilligte, nahm seine Frau nicht mehr. "Ich bin Krankenschwester und weiß, welcher Film abläuft", sagte Mary Pazdur. "Ich werde an dieser Krankheit sterben. Und ich will meine letzten Tage so gut wie möglich verbringen." Am 24. November ist Mary Pazdur im Alter von 63 Jahren gestorben.