Wie nur interessiere ich junge Leute für die Wissenschaft? Es wird viel Aufwand dafür getrieben, schon im Kindergarten gibt es Technik-Kurse, in der Schule geht es weiter mit Experimenten, mit Besuchen in Museen oder Hochschulen. Deutschlands Politiker werden nicht müde, die Bedeutung der Forschung zu betonen. Einer der besten Anstöße zum Forschen aber kam nicht aus der Politik, er kam von Henri Nannen, dem damaligen Chefredakteur des Sterns. Er suchte 1965 "die Forscher von morgen". Inzwischen haben Zigtausende an dem Wettbewerb teilgenommen. Selten dauert ein Programm so lange - und selten liefert es so anschaulich Erfolge. Die SZ zeigt sie in Porträts über Sieger aus 50 Jahren.
Vom Siegerfoto zum Wickie-Filmer
Florian Maier, 2. Preis Technik im Jahr 2000
Nach seinem Erfolg bei Jugend forscht hebt Florian Maier völlig ab. Das liegt nicht daran, dass er eine Firma gründet, die 3-D-Filme auch für Hollywood realisiert. Nein, das Abheben muss man wörtlich nehmen: Der Medientechnik-Student bewarb sich bei Europas Raumfahrtbehörde darum, sein prämiertes Fotoprojekt "frozen reality" 2006 auch in der Schwerelosigkeit bei einem Parabelflug zu erproben. Normale Fotos und Filme sind Florian Maier viel zu flach. Er will einen Raum zeigen, in dem er sich bewegen kann - und sehen, was sonst zu schnell für das Auge ist: Das Platzen eines Luftballons, wie bei seinem Siegerbild für Jugend forscht, oder das Auftreffen einer Kugel in Flüssigkeit, die durch den Raum schwebt.
Um einem eigentlich zweidimensionalen Bild Tiefe zu geben, stimmte Maier neun lasergesteuerte Fotokameras aufeinander ab. Doch ein normaler Blitz wäre viel zu langsam, um genau den Moment einzufangen, in dem die Ballonhaut zerreißt. Also musste Maier lernen, andere von sich und seinem Projekt zu überzeugen: Eine Firma lieh ihm kostenlos ein Ultrakurzzeit-Blitzgerät, "von dem gab es damals wohl nur drei weltweit". Der 20-Jährige fügte die neun Einzelbilder des zerplatzenden Luftballons so zusammen, dass der Betrachter die Szene fast umrunden kann - ein optischer Effekt ähnlich den "Matrix"-Filmen.
Auch auf andere Weise war der Wettbewerb wichtig für ihn, nicht nur, weil er so einmal im Leben in der Schwerelosigkeit sein durfte: Er fand Freunde, die ihm Rat gaben für seinen Weg in die Selbständigkeit, und Geschäftspartner. Einer der Hersteller, die ihn als Jungforscher kostenlos unterstützten, ist heute ein wichtiger Zulieferer für seine Firma Stereotec, die weltweit 3-D-Filmtechnologie anbietet. Die Ästhetik der Bilder hat Maier stets fasziniert, genauso wie die Technik dahinter.
Für intensiveres Erleben
Während sonst Regisseur und Kameramann entscheidend sind, kommt beim 3-D-Film eine weitere Schlüsselrolle hinzu: der Stereograph. Am Set ist Maier dafür zuständig, wie die räumlichen Bilder am besten wirken. Und dass dem Zuschauer im Kino nicht die Augen schmerzen, sondern er die Geschichte intensiver erlebt. Noch müsse er Regisseure erst dafür begeistern, 3-D-Aufnahmen als weitere Möglichkeit zur Gestaltung anzusehen. Stimmungen werden wie mit warmen und kühlen Farben erzeugt: Ein flaches Bild vermittelt Ruhe und auch Eintönigkeit. Wenn aber zum Beispiel die Hauptfigur in eine bunte Parallelwelt eintaucht, springen die Objekte förmlich aus der Leinwand.
So lässt Maier bei "Wickie auf großer Fahrt", der ersten deutschsprachigen 3-D-Produktion mit realen Darstellern, bei einer Zahnzieh-Aktion einen Pfeil in den Kinosaal schießen. Er zeigt die Nähe und Distanz zwischen Wickie und seinem Vater durch wohldosiert eingesetzte 3-D-Effekte, die der Zuschauer fühlt, aber nicht bewusst wahrnimmt. Mit dieser Tiefenwirkung konnte Stereograph Maier unter anderem beim Paramount-Film "Hänsel und Gretel: Hexenjäger" überzeugen, aber auch bei Werbespots etwa für Volkswagen.

Wie kommt man als Student am besten an eine Wohnung? Wo geht man weg? Und was zeigt man dem Besuch von außerhalb? Der Studentenatlas von SZ.de und jetzt.de hilft beim Zurechtfinden.
Carina Lämmle, beste interdisziplinäre Arbeit 2011
Manchmal sind Maschinen wie Kinder, sie zicken herum und kosten mehr Zeit als gedacht. "So ein Gerät wächst einem schon ans Herz", sagt Carina Lämmle und meint das Massenspektrometer der Hochschule Biberach. Ein halbes Jahr brauchte Lämmle, um das mehrere Hunderttausend Euro teure Gerät wieder dazu zu bringen, so zu messen, wie es sollte.
Damals war Carina Lämmle 16 Jahre alt und "hauptberuflich" in der elften Klasse am Gymnasium. Doch ihr Wissen um das Spektrometer, mit dem chemische Substanzen in ihre Bestandteile zerlegt werden und die Masse von Atomen gemessen wird, machte sie zur jüngsten Dozentin Deutschlands. Bei einem Besuch der Hochschule entdeckte Carina Lämmle ein Massenspektrometer, das verdächtig still war. Der einzige Mitarbeiter, der sich mit dem Gerät auskannte, hatte Biberach verlassen. Nicht nur Lämmle, auch der Dekan sah die Chance: Er erteilte der kundigen Besucherin den Auftrag, das Spektrometer wieder instand zu setzen und seinen Studenten den Umgang damit zu lehren.
Ihre Freude am Forschen erklärt Carina Lämmle so: "Ich mache ungern etwas, das schon viele davor gemacht haben." Sie will Dingen auf den Grund gehen, bei denen sich andere mit der Oberfläche zufriedengeben. Ein Lehrer hatte der Wissbegierigen Jahre zuvor das Schülerforschungszentrum Südwürttemberg empfohlen, wo junge Menschen gemeinsam Roboter bauen und naturwissenschaftliche Probleme lösen - oder auch nicht. Als Forscher müsse man lernen, mit Frustrationen umzugehen, sagt Lämmle. Nur eine von hundert Ideen funktioniere. Auch deshalb ist es für sie so wichtig, im Team zu arbeiten.
"Das ist wie ein Familientreffen"
Es bedeutet der 20-Jährigen viel, nicht in die Schublade gesteckt zu werden zu den einsamen, verschrobenen Wissenschaftlern. "Wer beim Jugend-forscht-Wettbewerb mitmacht, ist kein Nerd aus dem Keller, der nicht über seinen Tellerrand hinausschaut." Sonst würde sie nicht weiterhin zu den Regional- und Bundeswettbewerben von Jugend forscht fahren: "Das ist wie ein Familientreffen." Auch ihr erfolgreiches Jugend-forscht-Projekt verwirklichte sie im Team: Gemeinsam mit Felix Engelmann und Simeon Völkel verbesserte Lämmle die Funktion eines Gegenstromchromatographen, mit dem Chemiker Stoffmischungen trennen - Lämmle hatte so die Inhaltsstoffe einer Zwiebel untersucht.
Ihre Eltern haben keine naturwissenschaftlichen Berufe. Den Rat, wie es mit einem Projekt oder ihrer Karriere weitergehen soll, holt sich Lämmle von Experten des Schülerforschungszentrums und von Jugend forscht. "Dieses konstruktive Feedback motiviert ungemein - und fehlt oft in der Schule, in der nur Noten zählen." Nun studiert Lämmle im vierten Semester Chemie an der TU München. Gerne würde sie danach weiter an der Uni forschen, aber: Ein interessantes Projekt mit Habilitationsstelle sei schwer zu bekommen. Da sei ein Job in der Wirtschaft nicht nur lukrativer, sondern auch langfristig sicherer. Das sagt sie mit Bedauern, denn: In einer Firma wäre sie nicht frei, zu erforschen, was noch keiner vor ihr erforscht hat.
Andreas von Bechtolsheim, Bundessieger Physik 1974
Mit sechs Jahren baute Andreas von Bechtolsheim den Kassettenrekorder seines Vaters auseinander. Er ist sicher nicht das einzige neugierige Kind, das seinen Forscherdrang zum Missfallen der Eltern an deren Sachen auslebt. Aber vielleicht war er der einzige Sechsjährige, der das Radio wieder zusammensetzen konnte.
Damit hatte der Junge beste Anlagen, um Spaß an Jugend forscht zu haben: Dreimal nahm der Schüler teil, dann gewann er mit seiner "Strömungsmessung durch Ultraschall". Und nahm Fertigkeiten mit, die ihm im Silicon Valley den Weg zum Milliardär ebnen sollten: Nicht nur eine gute Idee zu haben, sondern daraus ein Produkt zu entwickeln und es selbstbewusst anzupreisen. Wobei man nicht sagen kann, dass sein Gespür für lohnende Geschäfte bis dahin brachlag. Der Gymnasiast konstruierte für einen Bekannten Industriesteuerungen, für jedes verkaufte Gerät bekam er hundert Mark Provision und war im Elternhaus bald die Person mit dem höchsten Einkommen.
Wider die Beschränkungen
Seine Mischung aus Neugier, durchdachtem Arbeiten und einem gewissen Geschäftssinn verhalf Andreas von Bechtolsheim zu einem Platz auf der Forbes-Liste der reichsten Menschen der Welt. Nur 29 Deutsche sind derzeit wohlhabender als er. Einen Grund, sich in seiner alten Heimat am Bodensee zur Ruhe zu setzen, ist dieser Erfolg nicht - das wäre dem Wahl-Amerikaner wohl zu langweilig. Er mag Neues und die Herausforderung, während er Beschränkungen seines Forscherdrangs unerträglich findet.
So auch beim Studium der Elektrotechnik an der TU München: Wie frustrierend für ihn, dass Studenten dort keinen Computer nutzen konnten. Er wechselte in die USA und legte als Doktorand der Universität Stanford den Grundstein seines Erfolges: Aus der Idee, die Institutsrechner zu vernetzen, wird das Unternehmen Sun Microsystems - SUN steht für Stanford University Network. Es lief gut, sehr gut sogar. Nur langweilte Andreas von Bechtolsheim, der hier einfach "Andy" ist, die Firmenroutine bei Sun. Er stieg 1995 aus und gründete das nächste Start-up: Bei Granite Systems arbeitete er an Hochgeschwindigkeits-Servern - wieder so erfolgreich, dass er das Unternehmen schon ein Jahr später veräußerte. Mit seiner dritten Firma Kaelia schloss sich der Kreis: Sie wurde von Sun Microsystems aufgekauft.
Das Geschäft seines Lebens machte er aber, als er in andere investierte: 1998 berichteten ihm Larry Page und Sergey Brin von einer Idee, die auch Bechtolsheim mehr als vielversprechend fand, die Suchmaschine fürs Netz. Heute sagt man googeln, wenn man Internetsuche meint. Trotz des Reichtums kann Andreas von Bechtolsheim das Erfinden nicht lassen. Für ihn ist das Geld eher eine beruhigende Zahl, die nichts daran ändert, dass er gerne weiterentwickelt und Probleme löst. Derzeit hat er in der Hardware-Firma Arista Networks eine Doppelrolle: Er arbeitet in dem Betrieb, dessen Investor er ist. Das findet selbst Bechtolsheim ein wenig seltsam. Aber nur Schecks auszustellen, wäre einfach zu langweilig.
Professor Oliver Krüger, Bundessieger Biologie 1994
Einer der Höhepunkte im Jahr von Oliver Krüger ist es, wochenlang Seelöwen auf den Galápagos-Inseln zu beobachten. Fast genauso gern rennt er im Teutoburger Wald Bussarden und Habichten quer durch das Unterholz hinterher, um ihre Horste aufzustöbern. Noch immer. Dass sein Projekt wohl das längste in der Geschichte von Jugend forscht ist, liegt zum einen an dieser Leidenschaft. Und an seiner Mutter.
Ihr Sohn war kein Neunjähriger, der seine Nachmittage auf dem Bolzplatz verbrachte. Er verschwand im Wald - und kam mit toten Tieren nach Hause. In einer anderen Familie hätte er das wahrscheinlich genau einmal gemacht, aber Oliver Krügers Mutter ließ ihn gewähren. Als er Tiere in ihrer Waschküche skelettierte, als er Kadaver ausstopfte und sie vorher in der Gefriertruhe neben dem Braten zwischenlagerte. Schließlich hatte sie ihrem Sohn immer gesagt: Wichtig ist, zu tun, was einem Spaß macht. Und ihr Sohn liebt es, das Leben im Wald auszukundschaften und Zusammenhänge zu entdecken. Da gehören die toten Tiere einfach dazu.
Was aber Krüger von anderen unterscheidet: Seine Neugier schwand nicht mit der Kindheit. Als er mit 16 Jahren beschloss, am Jugend-forscht-Wettbewerb teilzunehmen, professionalisierte er seine Datensammlung. Er hielt genau fest, welche Bussardpaare erfolgreich jagten und brüteten - und welche kaum Nachwuchs durchbrachten. Und warum das so war. Als er auch noch eine zweite Vogelart, den Habicht, miteinbezog und zeigen konnte, wie sich die Raubvögel in den kleiner werdenden Jagdrevieren ins Gehege kamen, wurde er drei Jahre später zum Bundessieger.
Erste Forschungsreise von vielen
Mit diesem Erfolg öffnete sich die Welt für Oliver Krüger. Bei Jugend forscht gewann er einen Aufenthalt in den USA, fünf Wochen lang. Es sollte die erste Forschungsreise von vielen sein. Sein Studium in Bielefeld und Oxford finanzierte Krüger über ein Stipendium, dann ist fast zehn Jahre lang die Uni Cambridge seine Heimat. Zurück in Bielefeld dreht sich seine Doktorarbeit abermals um Habichte und Bussarde - und wird wieder ausgezeichnet.
Inzwischen reist Krüger weniger. Der Professor für Verhaltensforschung hat sich um einen Lehrstuhl zu kümmern: Für 50 Mitarbeiter und deren Projekte muss er Drittmittel akquirieren. Da ist er froh, wenn er mal raus kann, gerne ans Ende der Welt: nach Alaska, Russland oder eben auf die Galápagos-Inseln. Eine Insel, auf der das Trinkwasser importiert werden muss, zum Duschen ist es zu schade. "Da kriegt man die schönsten Dreadlocks, das muss man mögen", sagt Oliver Krüger. Er mag es. Seine Bussarde und Habichte hat er nie aus den Augen verloren. "Meinen alten Datensatz von 1989 nutzen wir noch immer." Vor allem jetzt, denn: "Der Super-Predator ist zurück!" Der Uhu. Er verjagt nicht nur Habichte und Bussarde und übernimmt ihre Horste, er verspeist sie. Es bleibt spannend im Teutoburger Wald.
Andreas Schleicher, Sonderpreisträger Technik 1984
Für Andreas Schleicher kam die Erkenntnis, dass Lernen Spaß machen kann, fast zu spät. In der Grundschule hatte ihm ein Lehrer bescheinigt, dass er für das Gymnasium ungeeignet sei. Dem Schüler Andreas kam es so vor, als sei er in eine Maschine gezwängt, die nach einem festen Raster arbeitete - in das er nicht passte und wohl auch nicht passen wollte. Zu seinem Glück durfte er es dennoch auf dem Gymnasium versuchen und traf dort auf Lehrer, die forderten, aber ebenso förderten. Ein paar Jahre später war Schleicher Einserschüler und nahm mit seinem Cousin Dierk am Jugend-forscht-Wettbewerb teil. Und noch ein paar Jahre später ist Andreas Schleicher weltweit bekannt als "Mr. Pisa", Erfinder der Bildungsstudie der Organisation für Internationale Entwicklung und Zusammenarbeit (OECD) in Paris.
Aber davor galt es, einen Wettbewerb zu gewinnen: mit "Sascha IV", einem Verfahren zur Spracherkennung am Computer. Und das zu einer Zeit, als Rechner klobige Kästen für Spezialisten waren, "aber wir hatten damals offenbar eine Nase dafür", sagt Schleicher. Wobei er sofort anfügt: Ohne Firmen, die ihr Computerwissen mit den beiden Schülern geteilt hätten, wären sie mit "Sascha IV" nicht weitergekommen. So aber leisteten sie ausgezeichnete Arbeit - ein Erfolg, der Schleicher erst auf den Gedanken brachte, Physik zu studieren. "Es ist so schade, dass Schulen abgeschottet von der Welt sind." Beim Jugend-forscht-Wettbewerb traf er das erste Mal auf Experten, die sich für ihr Fachgebiet begeisterten und Wissen vermittelten, aber dabei selbst noch Fragen stellten. "Die meisten Lehrer hingegen fragten nicht, sie hatten schon ihre Antworten."
Schock für Deutschland
Während seines Studiums an der Uni Hamburg traf Schleicher auf eine Schlüsselfigur in seinem Leben: den englischen Erziehungswissenschaftler T. Neville Postlethwaite. Der ließ ihn an einer Lese-Rechtschreib-Studie mitarbeiten, und von ihm lernte Schleicher, pädagogische Fragen mit Empirie zu beantworten. Nach einem zweiten Studium der Mathematik in Australien erhielt Andreas Schleicher den Auftrag, für die OECD die weltweit größte Bildungsstudie zu erarbeiten: Programme for International Student Assessment, die Pisa-Studie.
Was im Jahr 2001 folgte, war ein Schock, zumindest für Deutschland - die Ergebnisse der Studie stellten der Bildungspolitik ein überraschend schlechtes Zeugnis aus. Seitdem kritisiert Schleicher immer wieder das frühe Aussortieren der Viertklässler in Deutschland, das ihm selbst zu schaffen gemacht hatte. Schleichers Kinder mussten sich nicht durch die deutsche Grundschule kämpfen, sie wurden in Frankreich unterrichtet. Aber er habe sowieso Glück gehabt: Seine Kinder seien von sich aus vielseitig interessiert. Er selbst hatte sein Abitur in zwölf Fächern abgelegt und bekam eine glatte Eins. "Jedes einzelne begeisterte mich. Ich sah sie nicht mehr als eine Ansammlung von Fachwissen, sondern als Möglichkeit, die Welt zu sehen und zu hinterfragen." Sein Grundschullehrer hätte ihn nicht wiedererkannt.
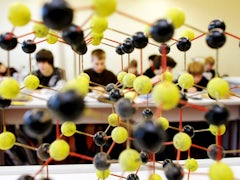
Vulkanausbrüche, Bienensterben, verstellbare Linsen: Beim aktuellen Pisa-Test liegt der Schwerpunkt auf naturwissenschaftlichen Fragen. Sind Sie so schlau wie die 15-jährigen Schüler? Testen Sie sich mit Beispielfragen der OECD.
Theodor Hildebrand, erster Bundessieger Mathematik, 1966
Die Zukunft kann Theodor Hildebrand nicht mehr überraschen, jedenfalls nicht, wenn es um Computer geht. "Das hatten wir doch alles schon", sagt er. Erst nach und nach werde umgesetzt, was er aus jahrzehntelanger Arbeit mit Netzwerken bereits kenne. "Und manches ist immer noch nicht da", sagt er.
Schon auf dem Gymnasium ging es ihm mit dem Schulrechner viel zu langsam. Also beschloss er, selbst einen Computer zu bauen, als Jahresarbeit für das Abitur. Es sollte ein Rechner sein, der sich nicht durch Relaisschaltungen quälen musste, sondern mit Transistoren die Informationen zügig weitergab. Weil die Halbleiter für einen Schüler zu teuer waren, durchsuchte Hildebrand die aussortierte Technik von Labors nach noch funktionsfähigen Transistoren. Etwa zwei Monate brauchte er, bis er das Material zusammenhatte und insgesamt neun Monate Nacht- und Sonntagsarbeit, um den Computer in Gang zu bringen. Als er fast fertig war, machte ihn ein Freund auf den neuen Jugend-forscht-Wettbewerb aufmerksam.
Der Computer war ein Erfolg. Er sei etwa hundert Mal schneller gewesen als der gemütlich vor sich hintickernde Relaisrechner an der Schule: "Der hat sich angehört wie eine Telefonzentrale, während man bei mir einen Knopf gedrückt hat, und das Ergebnis war da." Zwar konnte sein Computer noch nicht viel, nur die Grundrechenarten - aber das reichte, um anhand von Schaukarten die Funktionsweise zu erklären. Klein war der Apparat damals nicht: In einem ein Meter langen Kasten hatte Hildebrand etwa 50 Lochkarten angeordnet. Sehr anschaulich, und es funktioniert auch noch, fand die Jugend-forscht-Jury. Sie schickte Hildebrand in die USA, um den Rechner bei der Dallas Science Fair zu präsentieren - dort erreichte er den dritten Platz.
Anders als geplant
Der junge Tüftler war sehr beeindruckt von den USA, nicht nur weil dort gerade der Wettlauf um den Flug zum Mond die Nation elektrisierte: Ihn faszinierten die großzügigen Möglichkeiten für Forscher, das wollte er auch einmal haben. Zunächst aber studierte er in Bonn und Berlin Mathematik, und als endlich der Fachbereich Informatik eingerichtet werden sollte, half er dabei mit. Dann kam alles ganz anders.
Die Frau, die er kennenlernte und heiratete, war keine Amerikanerin, sondern Französin - er folgte ihr in die Heimat. Hier arbeitete er 35 Jahre lang für den IT-Dienstleister Atos, der elektronische Zahlung und Bankautomaten in Frankreich publik machte. Hildebrand baute eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung auf - und wurde als einziger Deutscher unter 800 Mitarbeitern gleich auf Geschäftsreise in die USA geschickt: Seine französischen Kollegen taten sich mit Englisch etwas schwerer als er. So landete Hildebrand doch noch zumindest als Gast im Silicon Valley, am Puls der Computerentwicklung.
Nebenbei wurde er als Experte in die Europäische Kommission geholt, wo er wissenschaftliche Projekte begutachtete und kontrollierte: Dafür habe er schon mal 400 Seiten in einer Stunde lesen müssen. Langweilig wurde ihm auch sonst nicht, er fühlte sich weiterhin wie ein Pionier. Mit seinen Kollegen im Silicon Valley habe er bereits 1979 in einem Netzwerk wie dem Internet gearbeitet und Rechner benutzt, deren Anwendungen nicht auf Servern liefen, sondern direkt im Netz: "Das gibt es heute noch nicht, alles schreitet sehr langsam voran", sagt Hildebrand. Er hat seine Neugier nicht verloren - und auch nicht seine Ungeduld.
